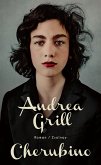Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Wortverspielt und mordverspielt: Helena Adler führt mit ihrem Roman "Fretten" einmal mehr in österreichische Elendsexistenzen
Sie sei eine Goschendiva aus der Provinz, sagte Helena Adler nach dem Erscheinen ihres Debütromans vor zwei Jahren gegenüber einer Journalistin des ORF. An krachigen Wortschöpfungen mangelte es der bis dato bildenden Künstlerin mit einer Vorliebe für Bruegel-Lupanarien schon damals nicht. Ihr Roman über eine vernagelte Bauernhofkindheit bei Salzburg war voller Theatralik. Die Sprache tat dabei wie ein barockes Rüschenkleid ihre Arbeit am geschundenen Provinzkörper. Jetzt ist Helena Adlers zweiter Roman erschienen. Und auch er arbeitet sich an den bigotten und verrohten Verhältnissen innerhalb einer Bauernfamilie ab.
Wieder steht eine seelisch lädierte Protagonistin im Mittelpunkt aller Empfindung. Wieder ist die Erinnerung an dieses Empfinden eines, das nachblutet. Obwohl zunächst alles noch recht idyllisch wirkt: "Die Menschen schienen perfekt an ihr Umfeld angepasst und sahen aus wie das Gemüse, das sie aus der Erde gezogen hatten, und wie das Fallobst, das am Boden landete." Schnell wird klar, dass es sich bei der Familie der Heldin aber um vergorenes Fallobst handelt. "Die Vaterbäuche waren Kriegswampen, bis oben hin gefüllt mit den Traumata der Vorgenerationen, die Mutterkuchen ausgetrocknete Seen. Alles war ausgeweitet. Ich war umgeben von Tränensäcken, von Hautlappen, ausgedehnten Gebärmüttern." Ein enges Dorf, engstirnige Bauern, die fanatisch in Genealogien denken, in angewandter Lieblosigkeit trainiert sind und dazu bedauerlicherweise frömmeln. Im "Heurigen sitzen nur die Gestrigen", schreibt die Autorin zufrieden mit ihrem Wortspiel: eine Mutter etwa, die von "nebenan" kam aus Sicht des Vaters und sich entsprechend "daneben" benahm. Wer geliebt wird, wird verspottet, heißt es: "So will es die Familientradition, so geht das seit Generationen." Andersherum wird noch böser ausgeteilt: "Wer uns etwas anhaben wollte, wurde rufgemordet."
Wer unter solchen Eindrücken ins Leben startet, kann sich wohl nur selbst helfen. Das tut die Heldin. Sie schließt sich einer Art Randalierergang an, die aus dem Hinterland kommend die nahegelegene Stadt unsicher macht. Beziehungsweise die Villen am See. "Wir treten das Paradies, das uns zu Füßen liegt, mit ebendiesen, weil wir keine andere Wahl haben, als mit dem Fersensporn in die Fußstapfen unserer Eltern zu treten. Ihre Schuhe sind uns zu eng, so eng wie ihre Vierkantbauernhöfe, ihre Rindviehvillen, in denen sie sich an jeder Ecke die Kante geben und auf den Putz hauen, hinter dem dann auch nur eine weitere Schimmelschicht schimmert, die man mit dem Brett vorm Kopf nicht sieht, nur riecht."
Das alles klingt schlimm, ist schlimm, bleibt schlimm, und die Autorin findet schlimme Worte dafür. In der österreichischen Literatur ist das nichts Neues. Von Thomas Bernhard über Elfriede Jelinek bis hin zu Monika Helfer, vom bösen Liedermacher Georg Kreisler sowie dem bösen Filmemacher Ulrich Seidl: In Österreich arbeitet sich die Kunst an den polymorph-perversen Untiefen der nationalen Kleinkrämerseele ab und erfreut sich mit dem zwanghaften Genre großer internationaler Beliebtheit. So lässt sich Helena Adlers Suada gegen alles Verbappte und Verkappte dort motivisch zumindest anschließen.
In "Fretten" wird die Obstination mit der Verderbtheit kurzfristig aufgebrochen, als die Heldin Mutter wird. Doch sofort liegt ein unschönes Flair von Symbiose in der Luft. Die Lieblosigkeit der Herkunftsfamilie verkehrt sich in ihr Gegenteil: "Am meisten Angst habe ich davor, den eigenen Sohn zu verlieren. Zu vergessen, dass es ihn gibt. Davor, von ihm getrennt zu sein, und vor meiner Ohnmacht, der Hilflosigkeit, der Unfähigkeit, ihn auf Dauer beschützen zu können. Dem Wahn, der Sippe anheimzufallen, der Durchschlagskraft unserer Gesindelgenetik."
Das alles trägt die Autorin mit kalkuliertem Pathos vor. Dabei sind es vor allem die Kalauer, Alliterationen und düstere Drastik, die diese Prosa unfreiwillig komisch machen. Die "Samenspende" befindet sich hier - wo sonst?! - im "Seifenspender". Die Hebamme hebt ihren "Hebarm". Im "Körperschiff" der werdenden Mutter fährt "ein Junges, das ein Junge ist". Und die "Scham" wird in der Badewanne - wo? - na, unter dem "Schaum" versteckt. In einem Exkurs über Drogen sagt die Heldin zu ihrem Vandalen-Lover: "Dafür bin ich eine, auf die du Gift nehmen kannst."
Echte Kunst sei existenziell, steht einmal unvermittelt im Text. Doch genau diese Arbeitshypothese macht es einem schwer, den Schmerzensroman "Fretten" ernst zu nehmen. Er trägt übertrieben dick auf und bleibt dabei zugleich unverbindlich - das Lebensthema einer beklemmend gewaltvollen Familiengeschichte wirkt prätentiös in der Art seiner Darbietung. Und von einer Darbietung muss man bei Helene Adler, die als Person selbst sympathisch gesamtkunstwerkhaft wirkt, sprechen: Tragödie und Vaudeville liegen in ihren Büchern nah beisammen. So liest man diesen im Furor geschriebenen Roman einer "Goschendiva" vor allem als Bluff: "Mein Leib verduftet, mein Leben verdunstet, wenn ich verdufte, riecht es nach rüstigem Röster. Ich verende lebensdarbend, ich darbe ins Verderben, meine Verwesung eine Verwüstung. Und morgen nur mehr ein Gerippe in der Steppe neben dem Landstraßenstrich. Zurück bleibt eine Zurückgebliebene."
Auch wir, die Leser, bleiben zurück nach dieser deftigen Lektüre. Und widmen uns wesensverändert dem rüstigen Röstergeruch der eigenen Verwesungs- und Verwüstungsbiographie. "Und wem der Sinn nach etwas anderem steht", gebietet die Erzählerin, "der erblinde an diesem Text, der verschlucke sich an seiner eigenen Zunge, der erhänge sich am fehlenden Handlungsstrang und folge in gerader Linie dem kurzen Prozess von Leben und Tod." Zu Befehl! KATHARINA TEUTSCH
Helena Adler: "Fretten". Roman.
Verlag Jung und Jung, Salzburg 2022. 192 S., geb. 22,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH