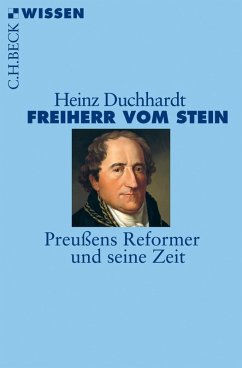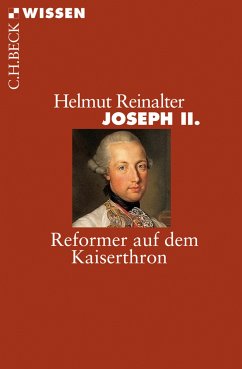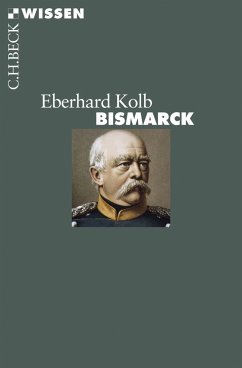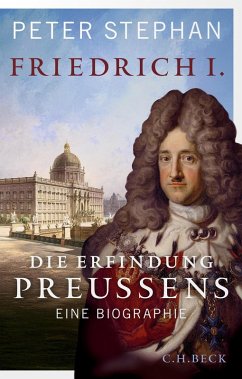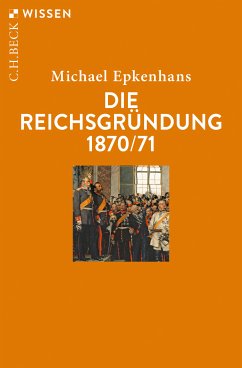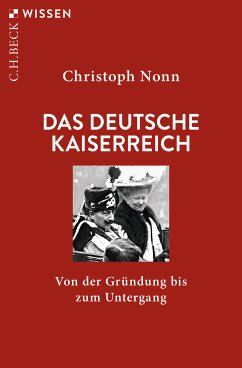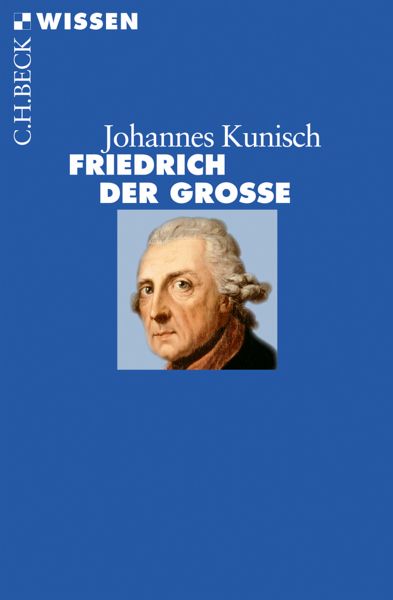
Friedrich der Große (eBook, ePUB)

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Friedrich der Große ist das Genie unter Preußens Herrschern ¿ und zugleich die Inkarnation all dessen, was an Preußen fragwürdig, unheilvoll und geradezu dämonisch erscheint. Johannes Kunisch, einer der besten Kenner des Königs unter den deutschen Historikern, schildert in diesem instruktiven Band die ambivalente Persönlichkeit Friedrichs, die Stationen seines Lebens und die Epoche des Ancien Régime. Er macht dabei überzeugend deutlich, dass der berühmte Preußenherrscher sich in den Bahnen seines Jahrhunderts bewegte, aber zugleich in vielen Bereichen, etwa der Rechtsprechung und d...
Friedrich der Große ist das Genie unter Preußens Herrschern ¿ und zugleich die Inkarnation all dessen, was an Preußen fragwürdig, unheilvoll und geradezu dämonisch erscheint. Johannes Kunisch, einer der besten Kenner des Königs unter den deutschen Historikern, schildert in diesem instruktiven Band die ambivalente Persönlichkeit Friedrichs, die Stationen seines Lebens und die Epoche des Ancien Régime. Er macht dabei überzeugend deutlich, dass der berühmte Preußenherrscher sich in den Bahnen seines Jahrhunderts bewegte, aber zugleich in vielen Bereichen, etwa der Rechtsprechung und der Staatsauffassung, erstaunlich modern war.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.