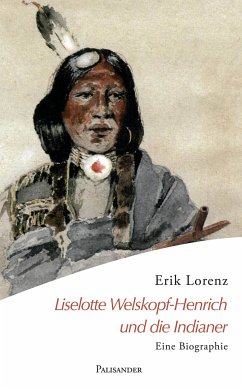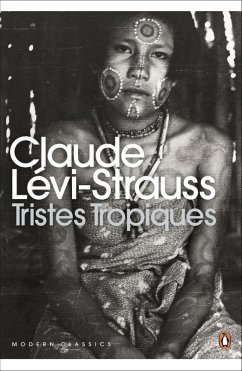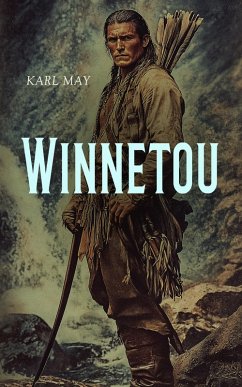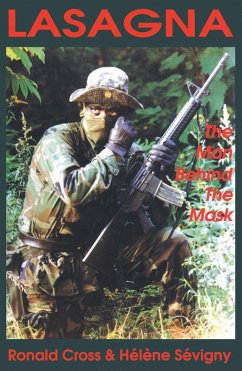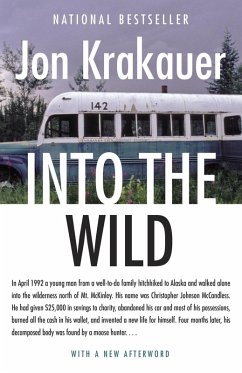Fünfzehn Tage in der Wildnis (eBook, ePUB)
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 15,00 €**
12,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Broschiertes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Während seiner großen Nordamerikareise, die eigentlich den Beobachtungen des amerikanischen Rechtssystems gewidmet war und der wir letztendlich auch sein Hauptwerk »Die Demokratie in Amerika« verdanken, begab sich Alexis de Tocqueville für zwei Wochen auf Abwege. Auf der Suche nach der Wildnis und den Ureinwohnern des Kontinents durchreist er den Bundesstaat New York, überquert den Eriesee und findet schließlich fast unberührte Täler im Distrikt Michigan. Der Bericht seiner Eindrücke und Begegnungen zeichnet ein unmittelbares Bild von der Verheerung und Erschließung, der Zerstörun...
Während seiner großen Nordamerikareise, die eigentlich den Beobachtungen des amerikanischen Rechtssystems gewidmet war und der wir letztendlich auch sein Hauptwerk »Die Demokratie in Amerika« verdanken, begab sich Alexis de Tocqueville für zwei Wochen auf Abwege. Auf der Suche nach der Wildnis und den Ureinwohnern des Kontinents durchreist er den Bundesstaat New York, überquert den Eriesee und findet schließlich fast unberührte Täler im Distrikt Michigan. Der Bericht seiner Eindrücke und Begegnungen zeichnet ein unmittelbares Bild von der Verheerung und Erschließung, der Zerstörung und Zivilisierung des Kontinents und seiner Bevölkerung.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.