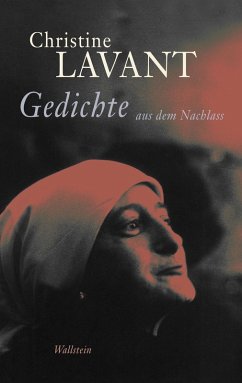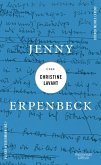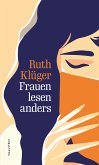Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Gottgefällig, gottverloren: Die nachgelassene Lyrik der großen Christine Lavant
Eines Tages - so könnte das Märchen einer Erweckung beginnen - bekam die arme Strickerin Christine einen Band Gedichte geschenkt: von Rilke, vermutlich das "Stundenbuch". Sie mochte sie zunächst nicht lesen, "weil man dabei nicht stricken kann". Als sie dann trotzdem las, überfiel sie die Inspiration. Es sei wie ein Wolkenbruch über sie gekommen, bekannte sie, und sie habe eine Weile fast Tag für Tag nur Gedichte geschrieben. Eine Dichterin war geboren: Christine Lavant, wie sie sich fortan nach ihrem Heimattal nannte.
Ihr bisheriges Leben war hart gewesen und blieb es bis zu ihrem Tod 1973. Christine Thonhauser, 1915 als neuntes Kind eines Kärntner Bergmanns geboren, war skrofulös, schwerhörig, schwachsichtig und konnte nur mit Unterbrechungen die Schule besuchen. Der Tod der Eltern kurz nacheinander traf sie tief und unterbrach ihre Schreibversuche für viele Jahre. 1939 heiratete sie einen sehr viel älteren Maler und blieb weiter aufs Stricken angewiesen. Dann geschah ihre Entdeckung: Die Schriftstellerin Paula Grogger hatte dem Verleger Viktor Kubczak einige Gedichte vorgelegt, und nach einigen Verzögerungen kam die literarische Karriere in Gang. Später, auf dem Höhepunkt ihres Schaffens, fand Christine Lavant die Formel für ihre Existenz: "Kunst wie meine ist nur verstümmeltes Leben."
Dieses verstümmelte Leben wurde kompromisslos für die Kunst gelebt; es führte zu Hauptwerk und Nachlass. Schließlich zu einer Werkausgabe, wie sie jetzt im Wallstein Verlag erscheint. Immerhin sagte Thomas Bernhard von dieser Dichterin, sie "ist eine der wichtigsten und sie verdient, in der ganzen Welt bekannt gemacht zu werden". Dabei war es nicht einmal leicht, sie in Österreich bekannt zu machen. Doch seit den Bänden "Die Bettlerschale" (1956), "Spindel im Mond" (1959) und "Der Pfauenschrei" (1962) galt Lavant als große Dichterin, abseits von Moderne und Avantgarde. Um ihren Erfolg machte sich ihr väterlicher Freund, der Publizist Ludwig von Ficker, verdient. Er verschaffte ihr Auszeichnungen, darunter zweimal den Georg-Trakl-Preis. Nicht minder wichtig war der Verlag Otto Müller, der die Bücher der frommen Empfindung anpasste. Lavant selbst bemerkte, dass man in Deutschland gern das druckte, was man in Salzburg zurückgewiesen hatte.
Nach 1962 verschlechterte sich der Gesundheitszustand der Dichterin; sie musste für längere Zeit in ein Pflegeheim. Ungedruckte Gedichte gab sie nicht mehr frei. "Ich hab mich ausgeschrieben", vertraute sie einem Freund an, und Hilde Domin erfuhr: "Mir graut es vor meinen Gedichten und eigentlich vor meiner Kunst." Doch sammelte sie ihre Manuskripte in Schachteln und Mappen und setzte ihren Neffen Armin Wigotschnig als Erben und Verwalter ein. Nichts sollte verloren gehen. Skrupel gegen die eigene Produktion waren Lavant fremd. Sie meinte: "Arme Gedichte wollen schließlich auch ,leben'. Wer das, was er schreiben muß, zurückhält, ist vielleicht wie ein Weib, das seine Kinder vergräbt aus Angst, sie könnten dem lieben Nachbarn nicht gefallen."
Christine Lavant, die kinderlose Frau, liebte ihre poetischen Geschöpfe. Dank dieser Einstellung und der Fülle der Überlieferung bringt der Nachlassband nun an die fünfhundert Gedichte; davon 365 Erstveröffentlichungen, die übrigen stammen aus früheren Nachlasspublikationen. Eine kleine Sensation ist, dass zu Anfang des Bandes ein ganzes ungedrucktes Gedichtbuch steht: "Die Nacht an den Tag". 1948 lag es schon als Korrekturabzug vor, doch der Druck scheiterte an den Verwirrungen der Nachkriegszeit, mit denen der aus Breslau geflohene Verleger Kubczak zu kämpfen hatte. Später hatte die Dichterin die Freude an ihm verloren: "Ich kann den Schund halt nimmer anschauen!"
Wie zu erwarten, steht "Die Nacht an den Tag" stark unter Rilkes Einfluss. Lavant dichtet virtuos den Ton des "Stundenbuchs" weiter. Er tönt aus Anfängen wie "Und manchmal hört man Gott vorübergehn!", "Er kommt zu Betern oft so ungewiss" oder "Er rundet uns so wie ein alter Töpfer". Doch gibt es auch Gedichte, in denen Lavant Rilke hinter sich lässt und von ihren alltäglichen Erfahrungen spricht. An Stellen, wo es um Armut und Elend geht, wagen sich auch die Gotteszweifel ans Licht: "Ob der liebe Gott bestimmt allmächtig ist? / Und ob er am Ende nicht doch vergisst, / dass die Mutter kein Geld für die Milch hat?"
In den späteren Passagen des Nachlasses wird die Gottesproblematik zentral. Was Ficker formelhaft "Lästergebete" genannt hatte, erscheint als eine Folge von Beschwörungen und Verdammungen, Hymnen und Blasphemien. Vieles ist ungeschützter und radikaler als in den zu Lebzeiten publizierten Bänden. In einem Abendgebet stehen "die erste Puppe und der liebe Gott" nebeneinander. Die Erlösungsgeschichte Jesu wird als bloße Erfindung angesehen: "Was hilft es mir dass einst ein Menschensohn / als Brot sich anbot - welch verrückte Sage." Gott selbst gilt als menschliche Projektion: "Gott - wenn ich ihn jeweils erfände."
Schwerlich lässt sich aus solch divergenten Aussagen ein System bilden. Solange das Dichten lebensmöglich ist, bleibt es für Lavant eine Art Selbsterlösung. "Alle Gnade liegt nur bei mir / und in dem Entschluss mich ganz ohne Beistand / innig von selbst zu beseelen." Damit ist nicht nur Gott in Frage gestellt, sondern auch das Dichten, ja das Gespräch über ihn. Schon 1959 schrieb Lavant, gleichsam vorausgreifend: "Immer mehr komme ich darauf, daß alles, was auf Gott und den Glauben Bezug hat, den Worten nach kaum je trocken und nüchtern genug gesagt werden kann."
Gleichsam kompensatorisch gibt es in den nachgelassenen Gedichten einen Realismus der Alltagswelt, der sich als veristische Bukolik äußert. Einmal klagt Lavant über ihren Ofen, der nicht zieht: "Mein kleiner Ofen bockt die ganze Zeit / und speit mir Rauch und Asche in die Augen." Und am Schluss des Gedichts ist sie es, die ihr warmes Herz in seine Nähe bringt. Zweimal wird der "Blaue Zug" beschworen, der in die große Stadt fährt; dabei ist er nichts anderes als ein Dieseltriebwagen der fünfziger und sechziger Jahre. Selbst die damalige Medienwelt ist präsent. Einmal heißt es ziemlich rätselhaft "Ein Blinder empfiehlt sich den tauben Ohren / durch das Lied von der Nordseeschwalbe." Eine Anmerkung hilft uns auf die Sprünge: Es war Hans Albers, der anno 1951 von der "kleinen Nordseeschwalbe" sang.
Der Nachlass zeigt nicht zuletzt, wie wenig Rücksicht Lavant auf Verständlichkeit und Publizierbarkeit ihrer Gedichte nahm. Auch ihre Selbstbekenntnisse haben eine gewisse Ungeniertheit. Nicht ohne Koketterie beginnt sie ein Gedicht mit dem Geständnis: "Ich bin ein einfaches und durchtriebenes Geschöpf." Thomas Bernhard, der sie seit 1956 kannte und 1987 die schöne Auswahl "Gedichte" veröffentlichte, muss diesen Vers im Kopf gehabt haben, als er an seine Lektorin Elisabeth Borchers schrieb: "Die Lavant ist eine völlig ungeistige, sehr gescheite, durchtriebene. Sie wohnt auf der Betondecke eines Supermarktes an einer Strassenkreuzung in Wolfsberg mit einer Riesentankstelle und tippt ihre Gedichte gleich in die Maschine. Das ist für mich grossartiger, als das verlogene Weltfremdmärchen mit katholischer Talschlussromantik, das gottbefohlene, das um sie bis heute immer verbreitet worden ist." Damals, im März 1987, war die Dichterin schon vierzehn Jahre tot, aber für Bernhard blieb sie gegenwärtig und tippte weiter. Da möchte man meinen, dass sie es noch immer tut. Jedenfalls sind ihre Gedichte immer noch lebendig.
HARALD HARTUNG
Christine Lavant: "Gedichte aus dem Nachlass".
Hrsg. von Doris Moser und Fabjan Hafner unter Mitarbeit von Brigitte Strasser. Mit einem Nachwort von Doris Moser. Wallstein Verlag, Göttingen 2017. 649 S., geb., 38,80 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main