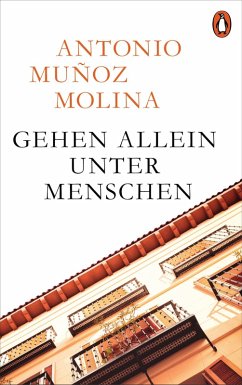Antonio Munoz Molina (Jg. 1956) zählt zu den wichtigsten spanischen Schriftstellern der Gegenwart. Sein Werk wurde mehrfach ausgezeichnet. In „Gehen allein unter Menschen“ begegnen wir ihm als schreibenden Flaneur, als anonymen Spaziergänger, der in Madrid, aber auch in Lissabon, Paris oder New York
unterwegs ist. Für ihn ist die Straße „das Büro der verlorenen Momente“. Hier ist er den Geräuschen…mehrAntonio Munoz Molina (Jg. 1956) zählt zu den wichtigsten spanischen Schriftstellern der Gegenwart. Sein Werk wurde mehrfach ausgezeichnet. In „Gehen allein unter Menschen“ begegnen wir ihm als schreibenden Flaneur, als anonymen Spaziergänger, der in Madrid, aber auch in Lissabon, Paris oder New York unterwegs ist. Für ihn ist die Straße „das Büro der verlorenen Momente“. Hier ist er den Geräuschen des Lebens auf der Spur, ist ganz Ohr und hört mit seinen Augen. Er ist der Blick, „der sich nicht einen Wimpernschlag ablenken lässt.“ Erliest jedes geschriebene Wort, dem er auf seinen Weg begegnet. Und natürlich hat er stets ein Notizbuch dabei.
Entstanden sind so mosaikartigen Beobachtungen und Notizen – meist nur eine Seite lang – die Augenblicke festhalten. Er berichtet vom Leben auf den Straßen, belauscht den Rhythmus der Stadt. Täglich entdeckt er etwas Alltägliches, das doch außergewöhnlich ist. Dann wandelt er auf den Spuren von Walt Whitman, Walter Benjamin, Edgar Allan Poe oder James Joyce, deren Leben in der Stadt er erzählerisch immer wieder streift.
In den Texten wird die Straße gewissermaßen zur Erzählung. So wie Munoz Molina ein-fach nicht aufhören kann zu schauen, kann der Leser / die Leserin nicht aufhören, dem Autor auf seinen Spaziergängen zu folgen, denn seine Texte und Gedanken sind Garant für Unterhaltung und eigenes Reflektieren. Man kann das Buch an jeder beliebigen Stelle aufschlagen und vertieft sich sofort in diese Mischung aus Selbstreflexion und literarischem Essay.