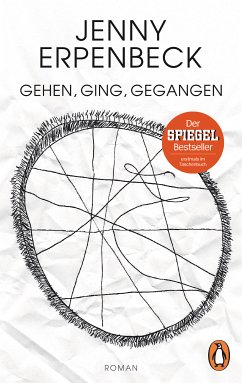Mea culpa
Nach dem mäßigen Vorgänger hatte ich an den neuen Roman «Gehen, ging, gegangen» von Jenny Erpenbeck keine hohen Erwartungen; allein mein Vorhaben, alle sechs Romane der diesjährigen Shortlist des Deutschen Buchpreises zu lesen, hat mich denn doch zur Lektüre bewogen. Zudem wurde dieser
Roman auch noch als Favorit gehandelt vom Feuilleton, was ja ebenfalls neugierig macht. Es war im…mehrMea culpa
Nach dem mäßigen Vorgänger hatte ich an den neuen Roman «Gehen, ging, gegangen» von Jenny Erpenbeck keine hohen Erwartungen; allein mein Vorhaben, alle sechs Romane der diesjährigen Shortlist des Deutschen Buchpreises zu lesen, hat mich denn doch zur Lektüre bewogen. Zudem wurde dieser Roman auch noch als Favorit gehandelt vom Feuilleton, was ja ebenfalls neugierig macht. Es war im übrigen mein letzter der sechs Finalisten-Romane, und im Rückblick kann ich nun die diesjährige Jury nur loben für ihren Sachverstand und Mut, Frank Witzels so gar nicht massentauglichen Roman über die Alte Bundesrepublik mit dem Preis zu ehren und nicht etwa den vorliegenden Roman mit seiner aktuellen Flüchtlingsthematik. Denn ein an sich begrüßenswerter Impetus und fleißige Recherchearbeit allein ergeben keinen guten Roman, wenn es wie hier an einer adäquaten literarischen Umsetzung fehlt.
Doch zunächst zum Plot: Richard, emeritierter Altphilologe, verwitwet, saturiert im eigenen Haus an einem See am Rande Berlins wohnend, mit viel Zeit, die er kaum zu nutzen weiß, wird unvermittelt mit den Problemen afrikanischer Flüchtlinge konfrontiert, die auf dem Oranienplatz ein Protestcamp errichtet haben, um auf ihre Situation hinzuweisen. Er kommt mit den allesamt jungen, männlichen Asylsuchenden in Kontakt, besucht sie immer wieder, führt lange Gespräche mit ihnen und erfährt so manches aus ihrem Leben, den bedrückenden Verhältnissen in ihren afrikanischen Heimatländern und der gefährlichen Flucht über das Mittelmeer nach Italien. Zunehmend tut sich ihm eine neue Welt auf, er hilft, wo er kann, nicht nur als Begleiter und Berater beim Verkehr mit Behörden, sondern auch finanziell und vor allem als persönlicher Freund. So ermöglicht er einem der Männer, an seinem Klavier zu üben, besorgt einem anderen eine Pflegejob, kauft einem Dritten ein Grundstück in seiner Heimat, mit dem die dort zurückgelassene Familie eine Existenzbasis erhält. Jenny Erpenbeck schildert sehr anschaulich und kenntnisreich den menschenverachtenden Behördenwahnsinn, der das Trauma dieser Gestrandeten zum Horror werden lässt. Als schließlich die Abschiebung unmittelbar bevorsteht, nehmen Richard und einige seiner Freunde die Männer der Oranienplatz-Gruppe privat bei sich auf. Die Geschichte endet mit Richards Geburtstagfeier, bei der alle Freunde und Asylsucher in seinem Haus zusammenkommen.
In einer bunten Mischung aus inneren Monologen, häufigen Reflexionen des auktorialen Erzählers und einsilbig knappen Dialogen, zuweilen mit englischen und italienischen Sätzen angereichert, wird eine Geschichte erzählt, in der so gut wie nichts passiert. Der Plot verharrt in einem spannungslosen Schwebezustand, der dem ungeklärten Asylstatus der jungen Afrikaner ähnelt und, wie man am Ende dann endlich weiß, auch zu nichts hinführt. Die Figuren, allen voran Richard, bleiben seltsam konturlos, sie sind allesamt nicht dazu angelegt, als Sympathieträger zu fungieren für den Leser.
Im Präsenz erzählt, sprachlich einfach und knapp gehalten, sehr direkt wirkend dadurch, wird die Lektüre besonders an den vielen Stellen schnell ermüdend, wo Richard seine Asylanten laienhaft nach ihrer Vorgeschichte befragt, man ahnt als Leser oft die Antworten voraus, vieles kommt einem jedenfalls bekannt vor. Die immer wieder mal eingestreuten Konjugationen werden irgendwann ebenfalls lästig, auch wenn sie wohl eine Sprachbarriere verdeutlichen sollen. Gleiches gilt für die reichlich eingebauten Redensarten, Liedtexte und Sprichwörter, die diese Geschichte vermutlich auflockern sollen, aber nur unsäglich albern wirken. Und wenn der Satz «Länger als eine Nacht konnte ich nicht bei Ihnen bleiben, dazu war ihr Zimmer zu klein» zum zehnten Mal vorkommt, fehlt mir jedes Verständnis dafür, der immer wieder erwähnte Ertrunkene im See nervt ebenfalls. Eine seltsame Erzählweise, die literarisch nicht geglückt ist, der ich jedenfalls absolut nichts abgewinnen kann – mea culpa!