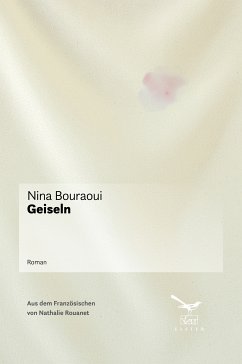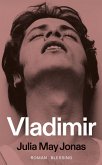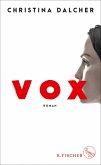Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH

Nina Bouraouis Roman "Geiseln"
Sylvie Meyer führt ein gewöhnliches Leben. Sie ist Mitte fünfzig, hat zwei Kinder, ihr Ehemann hat sie vor einem Jahr verlassen, aber damit kommt sie schon klar. Sylvie verantwortet die Produktionskontrolle in einem Unternehmen, das Gummi herstellt, ist ordentlich und fleißig. Ihr Chef vertraut ihr, tischt ihr Arbeit und selbstmitleidige Monologe auf. Eines Tages bittet er sie, Listen über die Fähigkeiten ihrer Mitarbeiterinnen zu erstellen, um die schlechtesten entlassen zu können. Ihren Werten entspricht das nicht, doch was soll sie tun? Sie will schließlich ihren Job behalten.
In ihrem Roman "Geiseln" zeichnet die französische Autorin Nina Bouraoui das Bild einer Frau, deren Gedanken viel freier und entschiedener sind als ihr Verhalten - zumindest bis zu einer Nacht, in der sie sich geradezu selbst mit ihrem Handeln überrumpelt. Der Roman ist aus der Ich-Perspektive geschrieben und wirkt durch seine klare Sprache wie ein langer Tagebucheintrag, der die Entwicklung von Sylvies Selbstreflexion offenbart. Sagt sie am Anfang etwa noch: "Ich kenne keine Gewalt und habe nie Gewalt erfahren", stellt sich später heraus, dass Sylvie sich das nur eingeredet hat, um ein Ereignis aus ihrer Jugend zu verdrängen. Definiert sie zu Beginn noch: "Arbeit ist eine Möglichkeit, glücklich zu sein oder wenigstens dem Glück näherzukommen", kommt sie später zu dem Schluss: "Arbeit ist und bleibt Unterwerfung"; sie sei etwas, dass sie "verletze".
Das zugrundeliegende Thema, das Bouraoui an Sylvies Figur aufzieht, ist die finanzielle und emotionale Abhängigkeit von Frauen. Beide zentralen Männer in Sylvies Leben, sowohl ihr Ehemann als auch ihr Chef, stoßen Sylvie über ihre Grenzen, und sie kann nichts tun, als sich der Tatsache zu beugen, dass der eine sie verlassen hat und der andere sie ausnutzt. Und dann ist da noch ein dritter Mann, was der Leser nicht gleich erfährt, der ihr noch viel mehr genommen hat.
Bouraoui war der MeToo-Debatte ein paar Jahre voraus, den Stoff zu "Geiseln" fand sie schon 2015. Er war als Theaterstück konzipiert und wurde in Frankreich mehrmals aufgeführt. "Das Schicksal meiner Heldin hat sich immer enger mit den Geschehnissen unserer chaotischen Welt verbunden, und so habe ich eine neue Version geschrieben", sagt Bouraoui über das Buch, das Nathalie Rouanet nun ins Deutsche übersetzt hat.
Die Gewöhnlichkeit von Sylvies Monolog macht seine Brisanz aus. Gerade weil die Dinge in ihrem Leben sind, wie sie sind, sind sie noch nicht auserzählt. "Frauen werden immer dem erstbesten Arschloch ausgeliefert sein. Das ist so, man muss es akzeptieren, aber ich akzeptiere das nicht", heißt es etwa. Ihren Alltag beschreibt Sylvie so: "Ein Blutegel, diese Langeweile. Er saugt alles heraus, ohne dass man es merkt, bis zu dem Tag, an dem man ihn wie einen Schlag ins Gesicht zu spüren bekommt, aber dann ist es schon zu spät." In der entscheidenden Nacht rebelliert sie gegen alles, was sie satt hat - den Chef, ihr bisheriges Leben -, und fühlt sie sich für ein paar Stunden wundersam frei.
In der Romanform erhält das Thema noch einen neuen Anstoß. Indem Sylvie etwas macht, was sie von sich selbst nicht erwartet hat, und die Erzählung an dieser Stelle erst richtig losgeht, greift Bouraoui eine wichtige Frage auf: Welche Mittel haben Frauen eigentlich, wenn sie auch mal Macht ausüben wollen? Und auch: Wie können sie sich tatsächlich gegen Männer behaupten, die meinen, die körperliche Unterlegenheit einer Frau sei der natürliche Beweis für Strukturen, wie sie in Sylvies Welt herrschen?
Das Buch hat darauf nur eine traurige Antwort, aber das ist seine Stärke. Sylvie scheint voller Widersprüche zu sein, stark und verletzlich zugleich. Sie reflektiert ihre Ausführungen mit Sätzen wie: "Ich will nicht auf die Tränendrüse drücken, aber das ist die Wahrheit", und beschreibt das von ihr empfundene Machtgefälle etwa so: "Es ist eine Stärke von uns Frauen, die Macht der Männer über uns zu verachten." Als sie überlegt, was sie getan hat, denkt sie: "Endlich war ich der Vergewaltiger." Dass selbst ein solcher Satz nicht irritiert, sondern für den Leser nachvollziehbare Erleichterung transportiert, ist nur ein Beispiel für die beeindruckende Sorgfalt, mit der die Autorin die Gedankenwelt ihrer Protagonistin aufgebaut hat. KIM MAURUS
Nina Bouraoui:
"Geiseln". Roman.
Aus dem
Französischen von Nathalie Rouanet.
Elster & Salis Verlag, Wien 2021. 160 S., geb., 19,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main