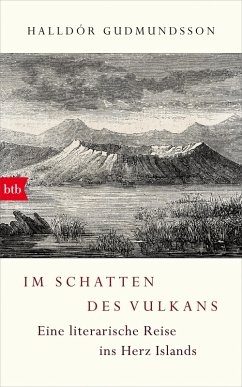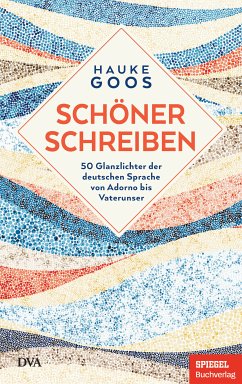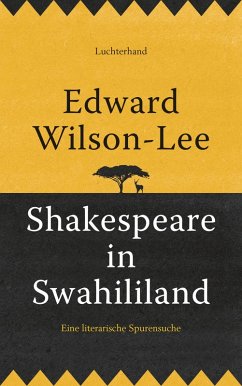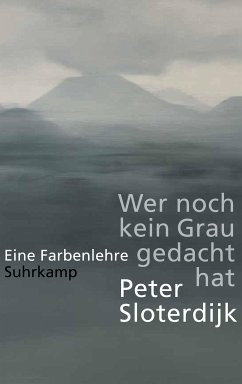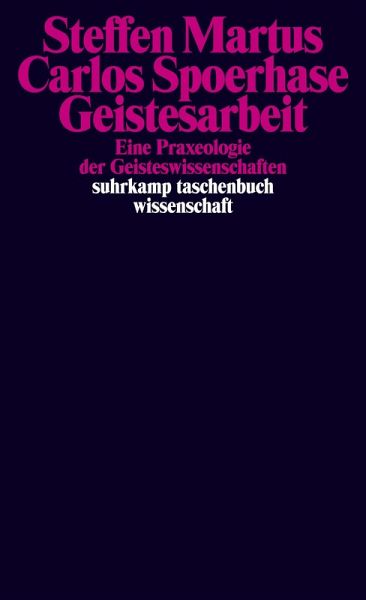
Geistesarbeit (eBook, ePUB)
Eine Praxeologie der Geisteswissenschaften
Sofort per Download lieferbar
Statt: 30,00 €**
29,99 €
inkl. MwSt.
** Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Der Ausdruck 'Geisteswissenschaftler' evoziert das Bild von einsamen Menschen am Schreibtisch, deren ganze Aufmerksamkeit der versunkenen Auseinandersetzung mit komplizierten Texten gilt. Aber stimmt dieses Bild? Nein, sagen Steffen Martus und Carlos Spoerhase, die in ihrem Buch im Rückgriff auf zahlreiche unpublizierte Quellen die Praxis der Geistesarbeit am Beispiel Peter Szondis und Friedrich Sengles untersuchen. Sie zeigen, was Forschen, Lehren und Verwalten im akademischen Alltag tatsächlich bedeuten, vor welchen Herausforderungen die Geistesarbeit jeden Tag steht und was sie leistet. G...
Der Ausdruck 'Geisteswissenschaftler' evoziert das Bild von einsamen Menschen am Schreibtisch, deren ganze Aufmerksamkeit der versunkenen Auseinandersetzung mit komplizierten Texten gilt. Aber stimmt dieses Bild? Nein, sagen Steffen Martus und Carlos Spoerhase, die in ihrem Buch im Rückgriff auf zahlreiche unpublizierte Quellen die Praxis der Geistesarbeit am Beispiel Peter Szondis und Friedrich Sengles untersuchen. Sie zeigen, was Forschen, Lehren und Verwalten im akademischen Alltag tatsächlich bedeuten, vor welchen Herausforderungen die Geistesarbeit jeden Tag steht und was sie leistet. Gegen die abstrakte Rede von der 'Krise der Geisteswissenschaften' plädieren sie für eine Neujustierung des Blicks, und zwar darauf, was an einem geisteswissenschaftlichen Arbeitsplatz wirklich geschieht.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, I ausgeliefert werden.