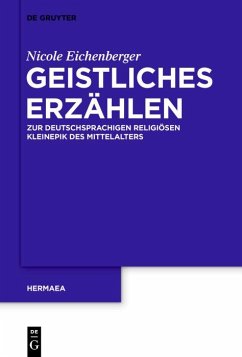Die Untersuchung befasst sich mit dem bisher in der Forschung wenig beachteten Texttyp der geistlichen Verserzählungen. Im Zentrum dieser kurzen Texte steht meist das Eingreifen der Transzendenz ins Leben der menschlichen Figuren. Durch ihre Thematik und ihre literarische Faktur ermöglichen die Texte sowohl Einblicke in die mittelalterliche religiöse Vorstellungswelt als auch in die verschiedenen erzähltechnischen und konzeptionellen Möglichkeiten, in der Volkssprache religiöse Inhalte zu bearbeiten.
Das Ziel der vorliegenden Untersuchung ist es, die Gruppe der geistlichen Verserzählungen als Texttyp zu beschreiben, wobei eine offene texttypologische Konzeption und ein multiperspektivisches Beschreibungsmodell dem Facettenreichtum des literarischen Phänomens gerecht zu werden suchen. Die handschriftliche Überlieferung der Texte bildet dabei einen Schwerpunkt.
Zahlreiche detaillierte Fallstudien leisten eine systematisch angelegte Aufarbeitung des Texttyps und stellen grundlegende Informationen bereit. Die darüber hinausgehenden texttypologischen, literatursystematischen und literaturhistorischen Ergebnisse der Untersuchung sind auch für andere Fragestellungen anschlussfähig.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
Matthias Kirchhoff in: Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur (ZfdA) 146, 2017/4, 519-525
"Das Buch Nicole Eichenbergers ist in seinem Anspruch ambitioniert, insofern es sowohl die Beschreibung eines postulierten Texttyps wie die seines Wandels über einen langen Zeitraum zu leisten beansprucht. Tatsächlich ist es der Autorin gelungen, ein Bild von der Vielfalt und Überlieferungsabhängigkeit der geistlichen Erzähungen zu zeichnen und dabei auch wichtige rezeptions- wie produktionsästhetische Perspektiven anzusprechen. [...] Mit der Arbeit ist eine Lücke, wenn schon nicht geschlossen worden (was nur die Forschung der Zukunft zu leisten vermag), so doch in texttypologischer und in literargeschichtlicher Hinsicht mit weiterführenden Thesen bearbeitet worden. Dass sich die Autorin aus der ganzen Fülle der mittelalterlichen geistlichen Kurzerzählungen und ihrer Varianten bedient, dabei auch Texte aus unedierten Überlieferungsträgern zitiert und zudem wissenschaftshistorisch ältere und neuere Forschungen gleichermaßen zur Kenntnis nimmt, zeugt von einer achtenswerten philologischen Grundhaltung, die nicht selbstverständlich ist."
Jörn Bockmann in: Arbitrium 37 (2019), Heft 2, S. 176