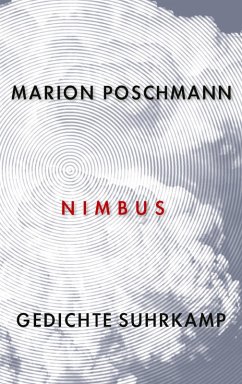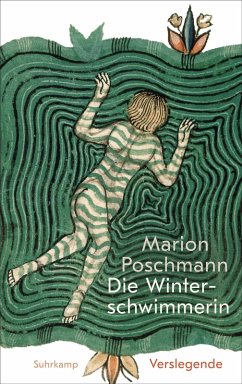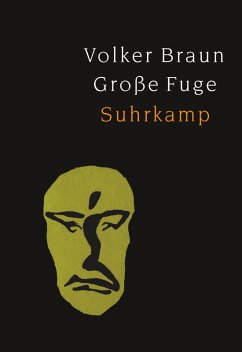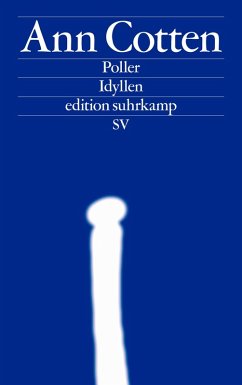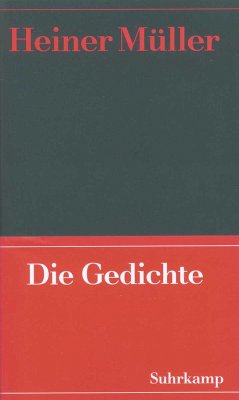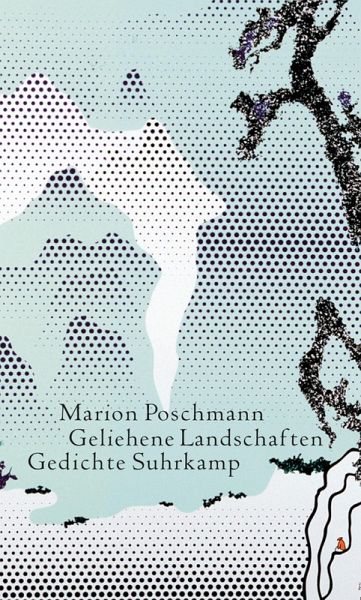
Geliehene Landschaften (eBook, ePUB)
Gedichte
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 19,95 €**
16,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
»Geliehene Landschaft« heißt ein traditionelles Stilelement in der ostasiatischen Gartenkunst. Eine Szenerie außerhalb der Gartenanlage, oft ein Berg oder ein imposantes Gebäude, wird bewusst in die Gestaltung mit einbezogen. Ein kleiner Raum öffnet sich so ins Weite und steigert seine Pracht. Nicht anders verfahren Gedichte. Ein Garten wird immer als paradiesisches Gefilde angelegt. Jeder Stadtpark kann als Jenseitslandschaft gelesen, jede öffentliche Grünfläche auf ihr utopisches Potential hin untersucht werden. Marion Poschmann leiht sich einen Lunapark in den USA oder ein Stück d...
»Geliehene Landschaft« heißt ein traditionelles Stilelement in der ostasiatischen Gartenkunst. Eine Szenerie außerhalb der Gartenanlage, oft ein Berg oder ein imposantes Gebäude, wird bewusst in die Gestaltung mit einbezogen. Ein kleiner Raum öffnet sich so ins Weite und steigert seine Pracht. Nicht anders verfahren Gedichte. Ein Garten wird immer als paradiesisches Gefilde angelegt. Jeder Stadtpark kann als Jenseitslandschaft gelesen, jede öffentliche Grünfläche auf ihr utopisches Potential hin untersucht werden. Marion Poschmann leiht sich einen Lunapark in den USA oder ein Stück der finnischen Taiga und geht den spirituellen Sehnsüchten und politischen Implikationen nach, die in diesen Landschaften zum Ausdruck kommen. Ihre Gedichte reflektieren - teils in der Adaption klassischer Formen wie dem Lehrgedicht oder dem japanischen No-Spiel -, wie jede Landschaft als ästhetisches Konstrukt auftritt, und sie feiern die schöpferische Kraft der Sprache und der Natur.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, I ausgeliefert werden.