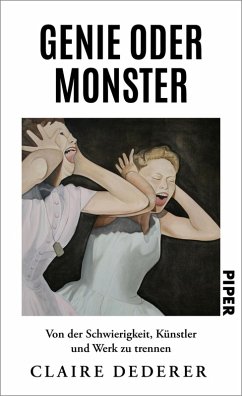Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH

Wie wir Werke und die Biographie ihrer Urheber miteinander verknüpfen: Claire Dederer denkt über das Verhältnis von Moral und Ästhetik nach.
Von Kira Kramer
Es gibt viele Wege, sich der Kunst zu nähern: intellektuelle, sinnliche, komparative. Die Freiheit des Zugangs gehört genauso konstitutiv zu ihr wie die Freiheit des Stoffs und der Form. Claire Dederer wählt eine emotionale Annäherung; eine, die ausklammert, was sie über die Bedeutung des Werkes weiß, auf das sie blickt, und stattdessen danach fragt, was sie bei der Betrachtung fühlt. Für sie gibt es Werke, die sie zugleich hasst und liebt. Es sind Werke, die in ihr einen Widerspruch aufreißen - Werke von Künstlern, die teils schwere Verbrechen begangen haben.
Als die Autorin 2014 für ein Buch über Roman Polanski recherchierte, war sie fassungslos über seine Tat von "monumentaler Monstrosität". Der Regisseur hatte 1977 die dreizehnjährige Samantha Gailey zunächst unter Drogen gesetzt und anschließend vergewaltigt. Als Dederer sich nun, im Wissen um die Tat, noch einmal mit seinem Werk befasste, war sie nichtsdestotrotz ergriffen von dessen "monumentaler Schönheit". Statt sich dem Reflex hinzugeben, Künstler und Werk voneinander zu trennen, und damit dem Problem zu entgehen, stellt Dederer sich der Unvereinbarkeit ihrer eigenen Imperative: auf der einen Seite, "tugendhafte Konsumentin und nachweislich gute Feministin" sein zu wollen, die Werke von Sexualstraftätern weder kauft noch schätzt, und auf der anderen Seite ein "ausgewiesenes Mitglied der Welt der Kunst" zu sein, das diese Werke kennt und rezipiert.
Dieses Spannungsverhältnis erörtert die Autorin in ihrem Buch "Genie und Monster. Von der Schwierigkeit, Künstler und Werk zu trennen". Im Titel klingt jene Polarität bereits an, die für Dederer dazu führen wird, dem Leser keine einfache Antwort anbieten zu können - oder vielmehr zu wollen. Das muss sie aber auch gar nicht, um ihre Selbstbefragung lesenswert zu machen.
So antiquiert der Begriff des Genies auf den ersten Blick klingen mag, so subversiv ist Dederers Methode: Sie tritt als Ich-Erzählerin auf und stellt damit ihre Subjektivität in den Mittelpunkt, ungeachtet des womöglich naheliegenden Vorwurfs, damit den Anspruch auf Objektivität einzubüßen, den sie per se infrage stellt. Etwa wenn sie schreibt: "Wer ist eigentlich dieses 'Wir', um das es in kritischen Schriften immer geht? Wir ist eine Hintertür. Wir ist billig. Wir ist eine Möglichkeit, gleichzeitig persönliche Antwort von sich zu weisen und sich in den Mantel der Autorität zu hüllen. Es ist die Stimme des mittelmäßigen männlichen Kritikers, der tatsächlich glaubt, zu wissen, wie alle anderen denken sollten." Dederer ist sich bewusst, dass nicht jeder auf Kunstwerke blickt, wie sie es tut, und dass es keine universell gültige Weise der Betrachtung gibt, die dem Wesen von Kunst ohnehin zuwiderlaufen würde. Das heiße aber nicht, Kunst könne nicht wahr sein. Sie bleibe gleichwohl häufig uneindeutig, in ihrer Weise Wahrheit auszusprechen.
Deshalb versucht Dederer gar nicht erst, ihre Beschäftigung mit Woody Allen auf seine Rolle als Filmemacher zu stützen, vielmehr wählt sie ihn wegen ihrer eigenen Verbundenheit mit seinem Werk: "In meiner Jugend fühlte ich mich Woody Allen seelenverwandt." Sie habe sich in seinem Werk repräsentiert gesehen. Lange hielt sie "Manhattan" (1979) für seinen besten Film. Darin spielt Allen den 42-jährigen Gagschreiber Isaac, der eine 17 Jahre alte Freundin, Tracy, hat. Doch als Dederer erfuhr, dass Allen mit Soon-Yi Previn, der Tochter seiner damaligen Lebensgefährtin Mia Farrow, geschlafen hatte (zu diesem Zeitpunkt war diese mutmaßlich noch in der Highschool), konnte sie seine Filme für viele Jahre nicht mehr ansehen. "Ich empfand den Sex mit Soon-Yi als schrecklichen Verrat an mir persönlich." Schließlich sah sie ihn sich doch wieder an, und Allens Tat schwang in jeder Szene mit.
Für Dederer ist Kunstbetrachtung stets die "Begegnung zweier Biographien: der Biographie des Künstlers, die den Werkgenuss stören kann, und die Biographie des Betrachters, die vielleicht beeinflusst, wie er die Kunst in sich aufnimmt". Insofern bezeichnet sie mit dem Begriff "Genie" ebenso wenig etwas Statisches wie mit dem Gegenstück "Monster". Immer wieder setzt Dederer neu an, sucht Zugänge, probiert Standpunkte, denn die Geschichte des Rezipienten kann im Moment der Betrachtung nicht abgeschlossen sein, wie auch der Blick auf das Werk damit unfertig und wandelbar bleibt.
Die dreizehn Kapitel hangeln sich am Werk verschiedener Künstler entlang, von den Genannten über Pablo Picasso, Michael Jackson und Ernest Hemingway bis zu J. K. Rowling und ihrer Transphobie und Joni Mitchell, die sich für die Kunst und gegen ihr Kind entschied. Dederer gelingt mit "Genie oder Monster" eine Streitschrift, die selbst vor ihrer eigenen Monstrosität nicht haltmacht. In ihren Ausführungen schlägt eine Kunstfertigkeit durch, die dem Sujet auf zweiter Ebene Schlagkraft verleiht. Es ist das Werk, das wir in Zeiten von Till Lindemann gebraucht haben - und mit "Wir" meint die Autorin dieser Zeilen freilich: sich selbst.
Claire Dederer: "Genie oder Monster". Von der Schwierigkeit, Künstler und Werk zu trennen.
Aus dem Englischen von Violeta Topalova. Piper Verlag, München 2023.
320 S., geb., 24,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main