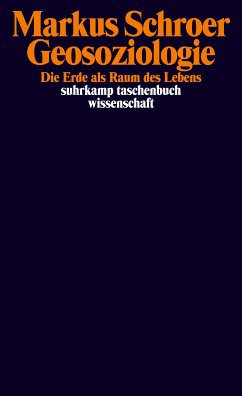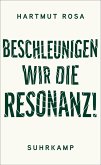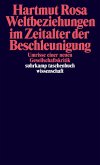Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, I ausgeliefert werden.

Was erdräumliche Verhältnisse bedeuten: Markus Schroer
sieht Nachholbedarf für das Studium von Mensch und Gesellschaft im Anthropozän.
Als Bruno Latour Ende der Siebzigerjahre seine ersten Beiträge zur Akteur-Netzwerk-Theorie veröffentlichte, war das mehr als eine Ausweitung der soziologischen Denkzone. Die teils empörten Reaktionen aus seinem eigenen Fach verrieten, dass hier jemand eine Ausweitung der Kampfzone begonnen hatte. Latour erntete Kopfschütteln für seine Forderung, zukünftig auch Natur und Technik als mithandelnde Akteure zum Gegenstand der Soziologie zu erklären.
Aber dann begann das Anthropozän. Und mit ihm die Suche nach einer Theorie für dieses Zeitalter, die nicht nur die Einheit von Erd- und Menschheitsgeschichte darstellen, sondern diesem Zeitalter auch den Schrecken nehmen sollte. Schließlich ist das Anthropozän in den zwei Jahrzehnten seiner Ausrufung bereits zum Metabegriff für die Krise geworden. Wie könnte die Soziologie dazu beitragen, dass der Mensch im Anthropozän nicht bereits schon wieder verschwindet?
Markus Schroer zufolge müsste sie zunächst einen fatalen Irrtum korrigieren. Er besteht in der Vorstellung einer zunehmenden Emanzipation des Menschen aus seinen "erdräumlichen" Verhältnissen. Im Anschluss vor allem an Bruno Latour, aber auch Michel Serres und Donna Haraway, fordert Schroer darum eine "Geosoziologie", weil sich das Soziale und die Natur kategorial nicht länger unterscheiden ließen. Für die systematische Erfassung des "Gesellschaft-Natur-Kultur-Hybrids" spricht nicht zuletzt, dass längst auch Disziplinen wie die Geowissenschaften nach Verbindungen in die Soziologie suchen. Das Problem ist nur, dass keiner antwortet. Ansätze, wenigstens das Ganze der Gesellschaft theoretisch zu fassen, sind seit der Archivierung der Systemtheorie Niklas Luhmanns eingestellt worden. Wer in der Soziologie Karriere machen möchte, sollte sich für Genderforschung, Sozialstrukturanalyse oder Migrationsforschung entscheiden. Aber einen soziologischen Beitrag zur Rettung des Planeten leisten? Der Spott, Gaia klinge wie Gaga, dürfte noch auf vielen Soziologentagen für Gelächter sorgen.
Natürlich müssen auch im Anthropozän noch Scheidungen erforscht, die Benachteiligung bildungsferner Schichten nachgewiesen und die Distinktionsgewinne der kulturellen Oberklassen zu Theorien der Gesellschaft verdichtet werden. Schroer dagegen sucht den Anschluss des Faches an Anthropologie, Zoologie und Philosophie. Dazu holt er ungeheuer weit aus: Ob Wetter, Klima und Boden, Tiere, Steine und Pflanzen, menschliche wie tierische Behausungen, Pflanzengesellschaften und die Konturen einer posthumanen Gesellschaft, Geopolitik, das Kapitalozän, Viren, Zoonosen und Schlachthöfe - überall zieht er Verbindungen, entwirft Netze und eine wechselseitige "Geopraxis" aller Lebewesen.
Doch nach der Lektüre der dichten sechshundert Seiten dieses Buches wird leider klar: Die Soziologie selbst kommt darin eigentlich nicht vor. Es gibt noch keine Geosoziologie, und Schroer hat sie auch nicht geliefert. Sein Buch ist darum der äußerst profunde Nachweis einer Leerstelle. Das zentrale Anliegen, der Soziologie eine "intellektuelle Verarmung" und eine "völlig unnötige Reduzierung ihres Gegenstandsbereichs" nachzuweisen, gelingt Schroer einwandfrei. Dass das nicht originell ist, sondern von Latour und Haraway stammt, ist aber nicht das eigentliche Problem dieses Buches. Das Problem ist, dass sich Schroer für die heutige Fachsoziologie genauso wenig interessiert wie diese sich für seine Gewährsleute aus Philosophie, Anthropologie, Dichtung und dem Film.
Welche soziologischen Felder haben denn bereits mit Naturbezügen zu tun? Die Konsumforschung? Die Techniksoziologie? Oder wenigstens die Agrarsoziologie? Die meisten Teildisziplinen des Faches dürften hier abwinken und ihr Desinteresse mit ihrer Nichtzuständigkeit begründen. Die Gesellschaftstheorie dagegen müsste sich betroffen zeigen, schließlich wirft nicht allein der Klimawandel die Frage auf, ob die moderne Gesellschaft überhaupt überleben wird. Ist die Geosoziologie darum eine strikt normative Theorie, die alles soziale Handeln unter den Vorbehalt stellen müsste, ob es zum Erhalt der Gattung beiträgt?
Erstaunlicherweise geht Schroer auf diese Problematik nicht ein. Ist die Geosoziologie eine Handlungstheorie? Die permanente Absicherung bei Latour würde das nahelegen. Aber wie verhält sie sich dann zur Theorie der funktionalen Differenzierung, die mit der Zoologie immerhin die Metatheorie der Evolutionslehre teilt? Könnte man ein gesellschaftliches Subsystem der Naturbeziehung jenseits der Wirtschaft entwerfen? Oder das mit dieser Theorie konkurrierende Prinzip der sozialen Differenzierung, also die Schichtung der Gesellschaft nach Einkommen und Bildung: Schon Ulrich Becks "Risikogesellschaft" von 1986 hatte ja klargestellt, dass sich auch die ökologischen Risiken gesellschaftlich ungleich verteilen würden. Wie wird die Gesellschaft des Anthropozäns sozial gegliedert sein? Das sind soziologische Schlüsselfragen, die die Geosoziologie zunächst einmal erforschen sollte. Bei Schroer kommt das alles nicht vor.
Was er thematisiert, sind die Klimadebatte und die Corona-Pandemie. Er streift jedoch eher distanziert durch die Klimapolitik, er referiert, aber er positioniert sich nicht. Er erwähnt zwar die Gefahr einer "Aushöhlung der Demokratie" durch so etwas wie eine Ökodiktatur, aber sein Gegenvorschlag einer "Ausweitung der demokratischen Akteure im Sinne des Neomaterialismus" bleibt substanzlos. Wer wären diese Akteure? Der Leser erfährt es nicht. Er erfährt auch nicht, warum Schroer die intensive soziologische Debatte während der Corona-Pandemie auf vier Seiten rasch abhakt, anstelle gerade diese Auseinandersetzung für eine Geosoziologie fruchtbar zu machen. Die empirischen Befunde wie etwa die soziale Schichtung der Bedrohungslage durch das Virus oder die zumindest zeitweilige Außerkraftsetzung der funktionalen Differenzierung während der Pandemie verdienten eine eingehendere Diskussion.
Wer eine Ausweitung der soziologischen Denkzone fordert, sollte sie mit den bestehenden Zonen des soziologischen Denkens unter Anleitung der eigenen Theorien verbinden. Trotz eines umfangreichen Literaturverzeichnisses bleibt bei Schroer der Eindruck, dass das Sammeln von Fundstellen aus anderen Fächern und vom Film dafür nicht ausreicht. GERALD WAGNER
Markus Schroer: "Geosoziologie". Die Erde als Raum des Lebens.
Suhrkamp Verlag, Berlin 2022, 672 S., br., 30,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH