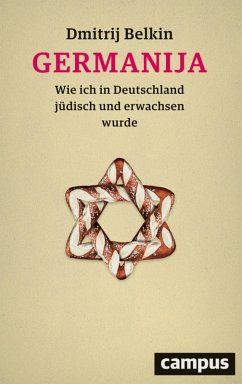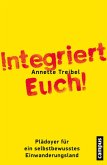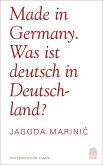Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH

Wie Dmitrij Belkin in "Germanija" sesshaft wurde
"Willkommen im Zoo" - so beschreibt Dmitrij Belkin die Reaktion seines damaligen Chefs auf seine Einbürgerung in Deutschland. Diese zynische Distanz vieler Deutscher zur eigenen Nation ist nicht das Einzige, womit der Autor dieses Buches, der 1993 aus der Ukraine in die Bundesrepublik kam, in seiner neuen Heimat fremdelt. Für ihn ist Deutschland aber kein Zoo, er blickt auf Land und Leute nicht wie durch Gitterstäbe. Seine Perspektive ist die eines distanzierten Insiders, der nach Zugehörigkeit strebt, ohne seine Herkunft und Geschichte zu verleugnen und ohne seine Beobachterposition am Rand aufzugeben.
Belkin verzichtet in diesem autobiographischen Text dankenswerterweise auf in der Migrantenliteratur beliebte Essensmetaphern à la "Currywurst und Döner". Seine Erfahrung spielt sich nicht einfach zwischen zwei kulinarischen Polen ab. Im Spannungsfeld zwischen sowjetischen, russischen, ukrainischen, deutschen und jüdischen Identitäten und Kontexten ist dies auch gar nicht möglich. Der Autor konstruiert sich auch nicht allein als Objekt deutscher Fremdenfeindlichkeit, obwohl Vorurteile seines Umfelds insbesondere gegenüber "Russland" und "dem Osten" immer wieder eine Rolle spielen.
Der Leser erlebt den "Migranten" Belkin vielmehr als handelndes Subjekt, als Individuum, das sich selbst entdeckt und die Gesellschaft, in die er sich "integriert", messerscharf analysiert. So diagnostiziert er Deutschland eine "Liebe zu den Schwachen (...) nur, solange sie schwach sind", während das Streben der Marginalen nach Macht und Anerkennung auf Befremden stoße. Diese Erkenntnis wird uns in der post-euphorischen Phase der "Flüchtlingskrise" sicher noch begleiten. Auch wundert sich Belkin über den Kampf seiner Osteuropa-affinen Kollegen gegen ihren "kollektiven Putin". Dieser habe wenig mit dem realen Russland und der realen Ukraine, aber viel mit der linken Vergangenheit altgewordener Achtundsechziger und der NS-Vergangenheit ihrer Eltern und Großeltern zu tun.
Die Suche des Autors nach sich selbst findet unter besonderen Umständen statt, auf der "Flucht vor dem 20. Jahrhundert", wie er es formuliert. Ausgangspunkt seiner Reise ist der Untergang seines Landes, der Sowjetunion, ein dramatischer Tiefpunkt nach der - heute fast vergessenen - Euphorie der Perestroika. Man kriegt bei der Lektüre ein Gefühl dafür, was dieser Einschnitt für die Biographien von Millionen Menschen bedeutete. "Everything was forever, until it was no more", so der Titel eines Buches des russisch-amerikanischen Anthropologen Alexei Yurchak über das Ende der Sowjetunion - diese Erschütterung von Gewissheiten, die auch Belkins Leben zeichnete, ist bis heute nicht ausgestanden.
Der junge Dmitrij will eigentlich nicht aus einem geliebten Dnepropetrowsk weg. Bleiben kann er aber auch nicht, zumal Anfang der neunziger Jahre niemand weiß, wie es weitergeht. Die Rückkehr des Eisernen Vorhangs erscheint eine reale Möglichkeit. Also wird er einer der vielen post-sowjetischen "bus people", die sich auf den Weg nach Westen machen. Zur Erinnerung: Ehemalige Sowjetbürger sind die größte Einwanderergruppe im heutigen Deutschland.
Auf seiner Reise lernt Belkin, der als "jüdischer Kontingentflüchtling" nach Deutschland kommt, die Paradoxien ethnizitätsbasierter Zuwanderung kennen. Sein Vater ist Jude, das macht ihn "jüdisch genug" für Deutschland, aber nicht für das Judentum, das nur mütterliche Abstammung anerkennt. Was ist schon "jüdisch" an ihm? Diese Frage treibt ihn um und bringt ihn an ganz widersprüchliche Stellen, zur christlichen Taufe und schließlich zur Konversion zum Judentum inklusive Beschneidung. Zu den Paradoxien gehört auch die Tatsache, dass Dmitrij erst in Deutschland wieder seinen russischen Namen tragen kann, nachdem die Ukraine aus ihm ungefragt einen "Dmytro" machte, der er nie sein wollte.
Dmitrij Belkins Buch ist kompakt und enthält doch mehrere faszinierende Erzählungen für den zeithistorisch interessierten Leser. Es ist eine Geschichte von Perestroika und Transformation, von Migration und Integration, eine Geschichte des neuen Deutschlands und nicht zuletzt eine Geschichte des neuen deutschen Judentums. Als zunehmend selbstbewusster post-sowjetischer deutscher Jude findet Belkin sich nicht einfach mit der ihm zugedachten Rolle als "Geschenk" für das geläuterte "Land der Täter" ab. Zugleich scheut er sich nicht, dankbar zu sein für die Aufnahme, die er gefunden hat - und trotzdem seine neue Heimat immer wieder an ihren neuralgischen Punkten zu hinterfragen. Solche Spannungsverhältnisse durchziehen die Erzählung und machen sie zu einer hellsichtigen Analyse der bundesdeutschen Gegenwart. Wer die Umwälzungen der letzten dreißig Jahre in Deutschland und Osteuropa und ihre Auswirkungen bis heute verstehen will, sollte dieses Buch lesen.
JANNIS PANAGIOTIDIS
Dmitrij Belkin: "Germanija". Wie ich in Deutschland jüdisch und erwachsen wurde.
Campus Verlag, Frankfurt a.M. / New York 2016. 202 S., geb., 19,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main