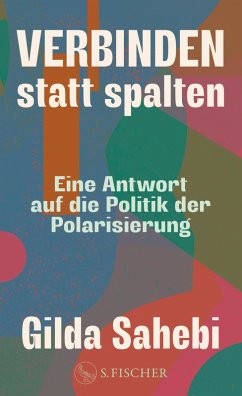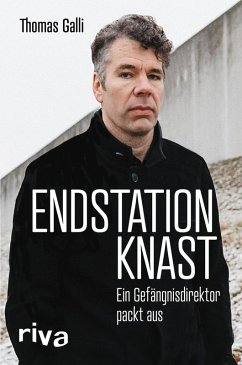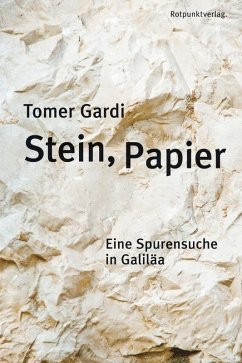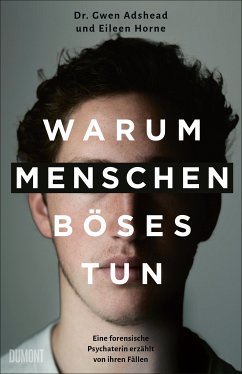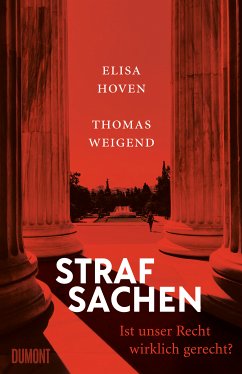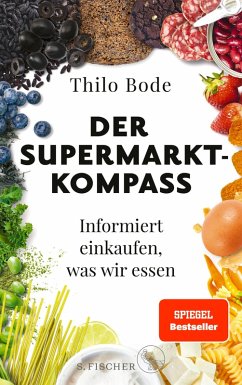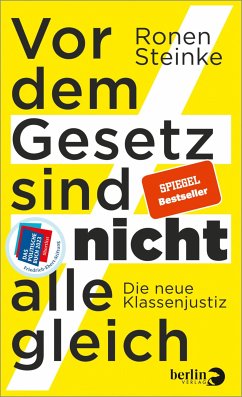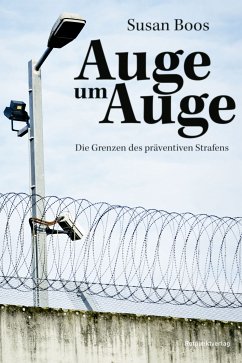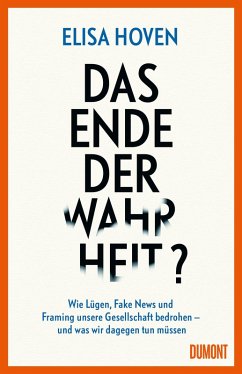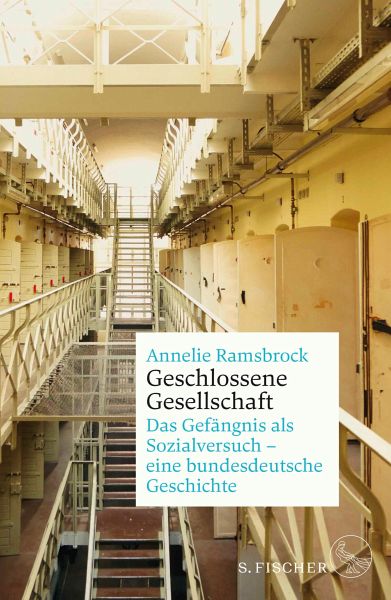
Geschlossene Gesellschaft. Das Gefängnis als Sozialversuch - eine bundesdeutsche Geschichte (eBook, ePUB)
Das Gefängnis als Sozialversuch - eine bundesdeutsche Geschichte
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 25,00 €**
22,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Das Gefängnis ist eine Institution, die unsere Gesellschaft herausfordert: Die Haft beschneidet die persönliche Freiheit, das höchste Gut in der Demokratie. Die Historikerin Annelie Ramsbrock erzählt, wie der westdeutsche Staat nach 1945 das Dilemma zu lösen versuchte: Das Gefängnis sollte künftig nicht nur Strafe sein. Es sollte die Straftäter resozialisieren. Wie in einem Labor versuchte man, die Ideale der sich demokratisierenden Bundesrepublik auch im Gefängnis zu vermitteln. Der Strafvollzug sollte liberalisiert werden, mit Arbeit und Ausbildung, Kunstaktionen und Sportveranstalt...
Das Gefängnis ist eine Institution, die unsere Gesellschaft herausfordert: Die Haft beschneidet die persönliche Freiheit, das höchste Gut in der Demokratie. Die Historikerin Annelie Ramsbrock erzählt, wie der westdeutsche Staat nach 1945 das Dilemma zu lösen versuchte: Das Gefängnis sollte künftig nicht nur Strafe sein. Es sollte die Straftäter resozialisieren. Wie in einem Labor versuchte man, die Ideale der sich demokratisierenden Bundesrepublik auch im Gefängnis zu vermitteln. Der Strafvollzug sollte liberalisiert werden, mit Arbeit und Ausbildung, Kunstaktionen und Sportveranstaltungen, Gruppentherapien und Wohngemeinschaften. Das Leben in Freiheit so weit wie möglich zu imitieren gelang aber nicht. Und so verläuft die Geschichte des Gefängnisses und des reformierten Strafvollzugs zwar parallel mit der Geschichte der Demokratisierung nach 1945 bis in die 1980er Jahre - und ist dennoch eine andere. Das Gefängnis blieb ein ganz eigener Ort, in dem Menschen auf engstem Raum streng reguliert zusammenleben - eine geschlossene Gesellschaft. Annelie Ramsbrock beschreibt diese Gesellschaft aus der Nahsicht und fragt am Ende, warum eine Resozialisierung im Sozialversuch Gefängnis nicht gelingen kann.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.