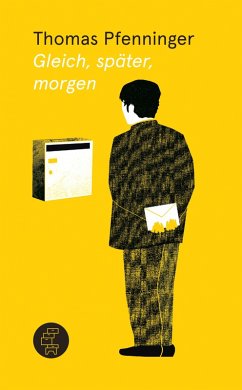Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Wo Schwäche verachtet wird, ist es umso imposanter, Schwäche zu zeigen:
In Thomas Pfenningers starkem Romandebüt "Gleich, später, morgen" setzt sich ein Mann über alle Regeln hinweg. Dann geht die Post ab.
Allein Jacques Derrida ist es gelungen, und auch das nur ein einziges Mal. In "Die Postkarte" (1980), einer Art allumfassender, selbstbezüglicher Korrespondenz zwischen Sokrates und Freud, bog er funkenschlagend die Postmoderne mit der Post zusammen. An sich aber ist das analogste und älteste aller Kommunikationsmedien wesenhaft prämodern. Es kommt nicht ohne auratische Realien aus, beschriebenes Papier, das eine andere, im besten Falle geliebte Person zuvor in Händen hielt. Auch bei Thomas Pfenninger, einem so gewitzten wie scharfsichtigen Schweizer Autor, der bislang mit Gedichten an die Öffentlichkeit getreten ist, hat die Post nichts gemein mit dem hypernervösen Geschnatter in digitalen Netzwerken. Seinen so lakonischen wie warmherzigen Briefträgerroman "Gleich, später, morgen" hat der Autor denn auch sicherheitshalber zurückdatiert in die frühen Neunzigerjahre.
Und doch geht es hier nicht um Nostalgie, sondern um anthropologische Konstanten. Alles, was Pfenningers namenloser Briefträger, ein unzuverlässiger, unbeholfener und leicht entrückter, dabei aber äußerst empathischer Held, im beschaulichen Züricher Südwesten erlebt, könnte wohl ebenso gut heute spielen. Einsamkeit und Sehnsucht, Überschuldung und Affären, Drogensucht und Spießigkeit, Schicksalsschläge und Blockwartmentalität, das Gerede und den Tratsch, all das gibt es schließlich immer noch in jeder besseren Nachbarschaft. Wer zwischen den so eng beieinanderlebenden, einander dauerbeobachtenden und doch letztlich wenig Substanzielles voneinander wissenden Menschen hin und her pendelt und erstaunlich intime Einblicke in ihr Leben hat - "Denn die Post, die jemand erhält, verrät viel: Absender, Interessen, Verstrickungen" -, das eben ist der täglich seine Runde drehende, als Mensch aber meist übersehene Briefträger.
Bedürfnisse hat indes auch er, eigenartige mitunter. Sind es zunächst nur einzelne Briefe, die der Protagonist zurückhält, ein amtliches Schreiben an den sich stets aufspielenden und den Jugoslawen Jozo offen verachtenden ehemaligen Postbeamten Schweizer oder eine Trauerkarte an die verbitterte alte Kälin, so weitet sich seine Übergriffigkeit bald aus. Angetrieben wird der Held, zumindest nach eigener Einschätzung, von Empathie. Einem überschuldeten Paar möchte er keine Rechnungen mehr zustellen, sondern begleicht sie lieber aus seinem Ersparten. Für eine verlassene Mutter fälscht er Briefe der fernen Tochter. Schnell wächst ihm das alles über den Kopf, aber mit Verstocktheit und Geschick (einem Anhänger mit doppeltem Boden) kommt er so lange durch, bis sich die gesamte Nachbarschaft in hellem Aufruhr befindet. Das Kartenhaus fällt schließlich zusammen, aber doch anders und tragischer als erwartet. Verliebt hat sich der Held dabei auch noch.
So harmlos der Plot anmutet, so pointiert, lakonisch und warmherzig ist der Roman erzählt. Wie der immer tiefer abrutschende Held, von Schweizer als "schlechtester Briefträger aller Zeiten" verhöhnt (aber eigentlich der beste?), sich selbst permanent mit apodiktischen Aussagen stabilisiert - "Zeit bringt Rat"; "In der Blamage liegt die härteste aller Bestrafungen"; "Schwächlinge können ihre Emotionen nicht verbergen" -, das hat Stil. Die Komik trumpft im Buch nicht auf, schwingt aber stets mit, wenn etwa das majestätische Durchfächern der Briefe mit Zeige- und Mittelfinger als "eines der herausragenden Erkennungsmerkmale eines großen Briefträgers" bezeichnet wird. Auch die leicht boshaften Beschreibungen des Züricher Wohlstandskleinbürgertums und seiner heimlichen Lüste sind formidabel in ihrer mitfühlenden Ironie.
Dass Kafka erwähnt wird, ist als Referenz dann aber doch zu hoch gegriffen. Auch wirken manche Beschreibungen zu verliebt in die eigene Kreativität: "Aus dem Obergeschoss tröpfelten Klavierklänge herunter, mit Fehlern durchzogen wie ein Spickbraten mit Fett." Zudem sind die Figuren oft eine Spur zu ausgestellt schräg, wenn etwa die Kälin einzig daran Gefallen findet, den Kirschen beim Faulen am Baum zuzusehen, und einen halben Bürgerkrieg anzettelt, als einige Jungs ihr die Früchte vom Baum stibitzen. Die Parodie ist eine Falle, würde sich der Briefträger in seinen Monologen hier wohl sagen.
So bleibt das Buch ein gut gelauntes, stilsicheres Debüt über die Vergeblichkeit, der Gesellschaft aus Liebe einzig gute Botschaften überbringen zu wollen, und den Respekt dafür, wenn es trotzdem jemand versucht. Wo das berühmte Vorbild, der von sich selbst berauschte Postangestellte in Charles Bukowskis "Der Mann mit der Ledertasche" - im Jahr 1971 ebenfalls das Prosadebüt eines zuvor nur mit Poesie hervorgetretenen Autors -, dem "System" mit hemmungsloser Exzessivität begegnete, zeigt sich die kaum weniger prononcierte Individualität von Pfenningers "geborenem Briefträger" ein halbes Jahrhundert später im Unterlaufen aller habitualisierten Endverbraucher-Exzesse im schweizerisch säuberlichen Vorgarten-Kapitalismus. Wo Schwäche verachtet wird, mit geradezu imposanter Schwäche die emotionale Vereinzelung zu durchbrechen, ist gelebter Widerstand. Das hätte der taffe Sokrates so zwar nie geschrieben, aber Freud vielleicht trotzdem herausgelesen, wäre die Postkarte nicht im doppelten Boden der Postmoderne verloren gegangen. OLIVER JUNGEN
Thomas Pfenninger: "Gleich, später, morgen".
Kommode Verlag, Zürich 2022. 280 S., geb., 22,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH