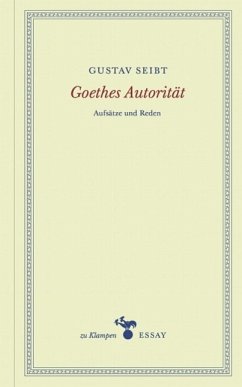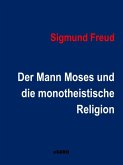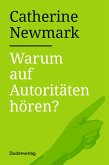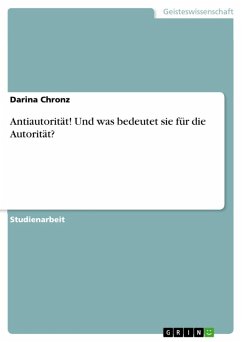Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Goethe war ein Sammler. Ob Steine, Gemmen oder Münzen, alles wurde fein säuberlich zusammengetragen und in seinem museumsähnlichen Haus verwahrt. Gustav Seibt könnte man als Goethe-Sammler bezeichnen. Keine Publikation ist ihm zu entlegen und keine Goetheschrift zu unwichtig, als dass er sie nicht zur Kenntnis nähme und als Baustein zu seinem Goethebild gebrauchen könnte. Diese Akribie hat etwas Beeindruckendes. Goethes Autorität besteht für Seibt, so im titelgebenden Essay seines jüngsten Büchleins, "in der Anziehungskraft eines in allen Bezügen interessanten, beispielhaft gelungenen, umfassend Sprache gewordenen Lebens". Stets geht es Seibt um die Würdigung einer exzeptionellen Lebensleistung, über alle Irritationen hinweg.
Auf den ersten Blick ungeheure Stellungnahmen und Einlassungen Goethes, etwa zu Napoleon, werden daher subtil gedeutet: "Goethes Entsetzen über den Brand von Moskau war so groß, dass er es in einem Brief an Reinhard vom 14. November 1812 trotzig leugnete." Und die vieldiskutierte Eheschließung mit Christiane Vulpius nach der Plünderung Weimars 1806 und das Bemühen des Dichters um ein geregeltes Erbe deutet Seibt als Goethes "ganz persönliche napoleonische Modernisierung": "Er verwandelte ständische Familien- und Besitzformen in bürgerliche." Weitere Beiträge gelten etwa Jacob Burckhardt und Friedrich Gentz, deren fortschrittsskeptischen Blick Seibt schätzt, oder der spöttisch betrachteten hauptstädtischen Preußennostalgie - das wahre "Herz unseres Landes" liegt nämlich in Thüringen. (Gustav Seibt: "Goethes Autorität". Aufsätze und Reden. Zu Klampen Verlag, Springe 2013. 175 S., geb., 18,- [Euro].)
meis
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main