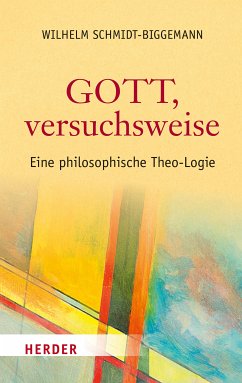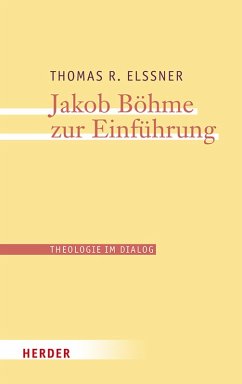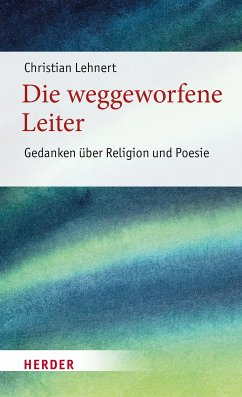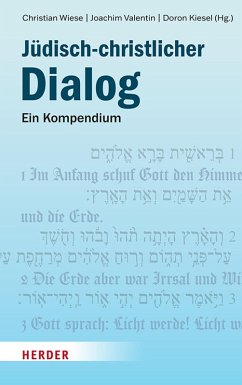Gott, Freund der Freiheit (eBook, PDF)
Ein Streitgespräch
Redaktion: Orth, Stefan
Sofort per Download lieferbar
Statt: 18,00 €**
13,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Magnus Striet und Helmut Hoping sind Antipoden in der theologischen Debatte. Während der eine seine Theologie ausgehend vom Begriff menschlicher Autonomie entwickelt, setzt der andere durchaus auch auf den Begriff der Freiheit. Er kommt aber angefangen vom Verhältnis zwischen kirchlichem Lehramt und Theologie, bei den klassischen Fragen katholischer Kirchenreform heute bis hin zu den ethischen Streitpunkten zu ganz anderen Schlüssen. In diesem Streitgespräch geht es um die Gottesfrage angesichts der modernen Naturwissenschaften und das Offenbarungsverständnis, die Ämterfragen bis hin zur...
Magnus Striet und Helmut Hoping sind Antipoden in der theologischen Debatte. Während der eine seine Theologie ausgehend vom Begriff menschlicher Autonomie entwickelt, setzt der andere durchaus auch auf den Begriff der Freiheit. Er kommt aber angefangen vom Verhältnis zwischen kirchlichem Lehramt und Theologie, bei den klassischen Fragen katholischer Kirchenreform heute bis hin zu den ethischen Streitpunkten zu ganz anderen Schlüssen. In diesem Streitgespräch geht es um die Gottesfrage angesichts der modernen Naturwissenschaften und das Offenbarungsverständnis, die Ämterfragen bis hin zur Priesterweihe der Frau und den Umgang mit den gesellschaftlichen Entwicklungen rund um Fragen der Sexualethik und Genderdiskussion.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.