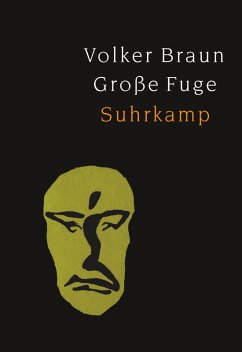Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, I ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH

Vom Elysium ins Illuseum zur Katarrhsis: Volker Brauns Lyrikband "Große Fuge"
Die Stadt ist ruhiggestellt wie ein Pestpatient / Ein Morgenfrieden bis Mitternacht / Entmenschte Straßen, wie befreit von der Krätze / Der Kunden": Ist das hier ein weiteres Lockdown-Werk, geschrieben unter dem Eindruck einer Wirklichkeit, die schon gar nicht mehr gültig ist - jetzt, da Straßen und Stadien wieder voll sind mit Durchdrehenden, kein Morgenfrieden zu haben ist und die "Krätze der Kunden" überall? Wohl kaum, denn das lyrische Ich dieses Gedichts hat mehr Misanthropie und Kartäusermentalität aufgestaut, als man wohl in der bisherigen Corona-Zeitspanne hätte sammeln können, dazu braucht es wohl viel längere Lebenserfahrung.
Dieses Ich zieht aus dem pandemiebedingten Stillstand eine bösartige Genugtuung. Während andere jammern über Schließungen und Kürzungen, jubiliert es: "Katarrh im Kulturbetrieb, einmal / all dem (Unfug) Einhalt gebieten EIN JAHR OHNE KUNST / So kommt Ruhe ins Verfahren, Ihr Dilettanten." Das ist schönstes Schimpfen und Protzen, wie es heute allenfalls noch im Hip-Hop, nicht aber im Kulturbetrieb erlaubt ist (Achtung, elitär!). Wenn es dann weiter heißt: "Ein fahler Hauch / Touchiert Deine Lungen, du atmest durch / Im Anthropozän", steckt in diesem Spott dann eine Club-of-Rome-Weisheit, nach dem Motto: Die Menschheit wird ja eh bald verschwinden? Das wohl nicht, denn das Gedicht trägt deutliche Zeichen der Ironie. Etwa, wenn es angesichts der Kürzung von Bedürftigen-Hilfe feststellt: "Auch die Tafel ist dichtgemacht, eine Schutzmaßnahme."
Hinter der Miesepeter-Rolle verbirgt sich vielleicht doch ein Moralist, aber das bleibt offen. Zumal, wenn der Dichter dann noch aus Ezra Pounds letztem "Canto" zitiert: "The scientists are in terror / And the European mind stops". Vielleicht doch kein so erstrebenswerter Zustand?
Auch der Titel des Gedichts, "Katarrhsis", enthält das Schwanken zwischen quälendem Schmerz und notwendiger Läuterung. Der Zug zum Kalauer, der in dieser Wortkombination steckt, ist auch anderen Stücken aus dem vorliegenden Band nicht fremd: Das Körper-Gedicht "Leibesbeweis" beklagt den kilometerlangen Darm des Menschen, aus dem "der Abflat keinen Ausweg findet". In einem anderen grüßt uns die herbeiphantasierte Wissenschaftshistorikerin Donna Haraway: "WELCOME TO THE KOM-POSTMODERNE".
Die ganz unterschiedlichen, zwischen Prosa und Lyrik schillernden Texte in diesem Band erhalten somit auch etwas Schelmisches, ein Sichaußerhalbstellen dessen, der alles erlebt und gesehen hat. Vielleicht so wie der Autor, Volker Braun, der mittlerweile 82 Jahre alt ist und sich lebenslang an den Gesellschaftsformen abgearbeitet hat, deren Zeitzeuge er wurde, im Sozialismus wie im Kapitalismus.
Vielleicht aber auch so wie seine Gewährsleute, die in diesen teils traumhaft zwischen den Epochen umherspringenden Texten bis zu Dante zurückreichen, den er in dem autobiographisch anmutenden Gedicht "Sechster Kreis" aufruft. Es führt an die Bornholmer Straße in Berlin, also an einen mit Bedeutung aufgeladenen Übergang zwischen zwei Welten. Den von der DDR zur BRD hat Braun hier selbst erlebt, "um aufzusteigen aus der kargen Sphäre. / Zum Kreis der Schlemmer!" Und doch stellt das lyrische Ich nun fest: "Merkwürdig mager ist man hier kahlköpfig / Wir sehn uns an: bin ichs? sind wir es? wie / Dante die Verbraucher vorgesehen hat".
Das Fazit lautet vorderhand: "Nicht ins Elysium, ins Illuseum / Hat mich der Weg allesamt geleitet". Ob sich dieses lyrische Ich von Text zu Text gleicht, ist schwer zu sagen, es wandelt jedenfalls beständig die Gestalt zwischen "Urmensch" und "Maschinenmensch", zwischen "Windbürger" und "panischem Freitagskind", das auf alten Schlachtfeldern "das Roastbeef Europas" liegen sieht oder den Geistern verstorbener Schriftsteller begegnet, immer dabei suchend seinen "Trampelpfad" heraus "aus den Systemen". Ehe man sich zu sicher ist, es einmal dingfest gemacht zu haben, versichert es: "Meinem Wesen entspricht / Seh ich das da / Daß ich Abstand halte und auf Anfrage twittere: / Ich bin / nicht der / Und meine Billigung / ihr / habt nicht."
Nicht zuletzt der Titel des Gedichtbandes schillert: "Große Fuge" kann auf einen musikalischen Versuch hindeuten, der an Beethovens gleichnamiges Spätwerk erinnert (vielleicht auch ironisch?) und durch den sich als Thema, wie verfremdet auch immer, Brauns eigener Lebensfaden zieht. Oder aber der Titel bezeichnet eine Zeit-Fuge, in die wir, die Leser, auch ohne Pandemie hineingezogen werden könnten, um innezuhalten. Beides ist, so wie der ganze Band, reizvoll rätselhaft.
JAN WIELE
Volker Braun: "Große Fuge". Suhrkamp Verlag, Berlin 2021. 56 S., geb., 16,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main