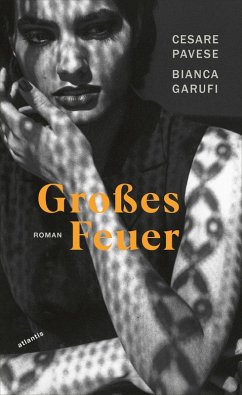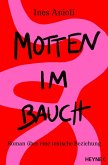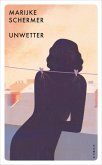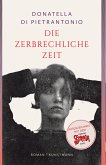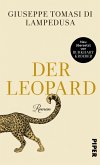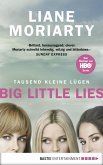Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH

Missbrauch in der Familie: Ein Roman zu vier Händen von Cesare Pavese und Bianca Garufi
Er hat es so fein raus! Allein wie er die Werte der Familie hochhält, dieser Dino, Rechtsanwalt und Kirchgänger, vor allem aber Stiefvater Silvias. Wie er ihr ins Gesicht sagt: "Nie habe ich deine Mutter betrogen, sie hat es verstanden, dass ich ihr nie unrecht getan habe. Mit dir, das war etwas anderes. Du und sie, ihr seid für mich eins." Wunderbar einfach! Weder die Ehe gebrochen noch des Nächsten Weib begehrt, da kann er doch glatt respektierter Kirchgänger bleiben, dieser Dino.
In dem schmalen Roman "Großes Feuer" berichten Bianca Garufi und Cesare Pavese aus je abwechselnder Ich-Perspektive, wie Silvia nach zehn Jahren an der Seite von Giovanni erstmals in ihr Heimatdorf im Süden Italiens zurückkehrt. Dino hatte ihr ein Telegramm geschickt, dass Giustino im Sterben liegt. Was bei der Lektüre sofort klar wird, was aber Giovanni - eventuell - erst am Ende des kurzen Aufenthalts begreift: Giustino ist nicht etwa Silvias Stiefbruder, sondern das Kind, das sie als Dreizehnjährige nach der Vergewaltigung durch Dino austragen musste.
"Großes Feuer" ist 1959, neun Jahre nach Paveses Selbstmord, in Italien erschienen. Bianca Garufi, die über C. G. Jung promoviert hat, hielt in der Einleitung zur damaligen Publikation fest, der Roman sei eigentlich umfassender geplant gewesen und habe Silvias Tod vorgesehen. Nun allerdings finde sie ihn faszinierend abgeschlossen und in sich stimmig. Recht hat sie.
Pavese hat sich in seinem Werk viel mit Mythen auseinandergesetzt und diese stets mit der Kindheit verbunden. Seinen Texten hat das nicht immer gutgetan, zuweilen wirken sie spröde oder steril. Ganz anders hier. Die Kindheit in der damals beschriebenen Zeit, vor rund hundert Jahren, sah zwar anders aus, das ändert aber nichts an der Wucht für die heutige Lektüreerfahrung, wenn diese Kindheit als Bezugspunkt völlig wegfällt, weil sie brutal zerstört worden ist. Silvia "kann sich nicht verlieben" und fühlt sich wie "ein Ungeheuer", meint, sie würde beim Sprechen nur "kurz Luft schnappen und dann gleich wieder versinken, runter in den Brunnen".
Der Roman beschreibt beklemmend, wie die Eigendynamik der Gesellschaft funktioniert, wenn es darum geht, Silvia die Schuld für den Missbrauch zuzuschieben. Oder wenn es darum geht, daraus den Freifahrtschein für weitere Vergewaltigungen abzuleiten, wie es der Lehrer tut, bei dem sie Hilfe sucht. Bis zum Ende trägt der doppelbödige Charakter der Schilderung den handlungsarmen, aber spannungsreichen Text, und gerade zu Beginn, wenn Silvia das Geschehen nur andeutet, ist der Perspektivwechsel atemraubend. In Italien galt lange Zeit Dacia Maraini als eine der Ersten, die Missbrauch in der Familie literarisch dargestellt haben, vor allem in ihrem exzellenten Werk "Die stumme Herzogin" von 1990. Pavese und Garufi ist dies noch komplexer gelungen, weil sie durch den Perspektivwechsel vielschichtiger gestalten können und der schlichte, oft stille Ton ungeheure Wut schürt. Zu vertraut ist diese Bigotterie. "Großes Feuer" ist ein schmaler Band - und ein großer Roman. CHRISTIANE PÖHLMANN
Cesare Pavese, Bianca Garufi: "Großes Feuer". Roman.
Aus dem Italienischen von Maja Pflug. Atlantis Verlag, Zürich 2022.
128 S., geb., 20,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»Langsam und in Sequenzen von schlichter, ja, bisweilen geradezu archaischer Schönheit entrollt uns das Autoren-Duo Garufi/Pavese in Form sich alternierend aufeinander beziehender Kapitel die jeweils ganz eigene Sicht der beiden Protagonisten.« Peter Hennig / Saarländischer Rundfunk
»Die 120 Seiten sind eine faszinierende Lektüre aus einem Guss, sowohl inhaltlich als auch stilistisch. [...] Das damals Neuartige dieser Sprache und Erzählweise wirkt auch heute noch modern und unverbraucht.« Günter Rinke / literaturkritik.de
»Langsam und in Sequenzen von schlichter, ja, bisweilen geradezu archaischer Schönheit entrollt uns das Autoren-Duo Garufi/Pavese in Form sich alternierend aufeinander beziehender Kapitel die jeweils ganz eigene Sicht der beiden Protagonisten.« Peter Hennig / Saarländischer Rundfunk
»Die 120 Seiten sind eine faszinierende Lektüre aus einem Guss, sowohl inhaltlich als auch stilistisch. [...] Das damals Neuartige dieser Sprache und Erzählweise wirkt auch heute noch modern und unverbraucht.« Günter Rinke / literaturkritik.de