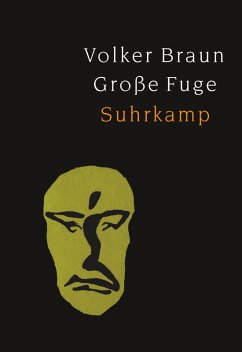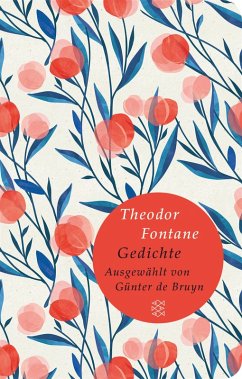Grund zu Schafen (eBook, ePUB)
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 15,90 €**
7,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Marion Poschmann, bekannt durch ihren von der Kritik hochgelobten Debütroman "Baden bei Gewitter" ("Die schönste Liebesgeschichte seit langem" FAZ), legt einen neuen Lyrikband vor. "Grund zu Schafen" heißt der zweite Gedichtband der gegenwärtigen Villa-Massimo-Stipendiatin. Bereits die Titel der Gedichte Marion Poschmanns evozieren Bilder und Gefühle. Die Dichterin zeigt uns die "Geometrie der Melancholie", erzählt uns von "Glasuren des Januar" und gibt lyrische Assoziationen zu Gemälden Cy Twomblys. Das lyrische Ich von Marion Poschmann präsentiert sich ganz unverstellt. Entstanden si...
Marion Poschmann, bekannt durch ihren von der Kritik hochgelobten Debütroman "Baden bei Gewitter" ("Die schönste Liebesgeschichte seit langem" FAZ), legt einen neuen Lyrikband vor. "Grund zu Schafen" heißt der zweite Gedichtband der gegenwärtigen Villa-Massimo-Stipendiatin. Bereits die Titel der Gedichte Marion Poschmanns evozieren Bilder und Gefühle. Die Dichterin zeigt uns die "Geometrie der Melancholie", erzählt uns von "Glasuren des Januar" und gibt lyrische Assoziationen zu Gemälden Cy Twomblys. Das lyrische Ich von Marion Poschmann präsentiert sich ganz unverstellt. Entstanden sind wundervolle, luzide Texte, ungereimt, aber voller Rhythmus. Es ist die Faszination des Wortes, der Nachklang der Bilder, die diese Gedichte zu einem großen Kunstgenuss machen.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.