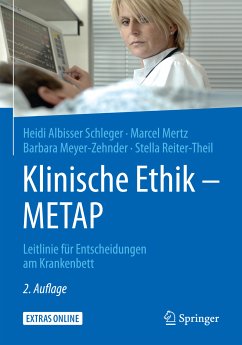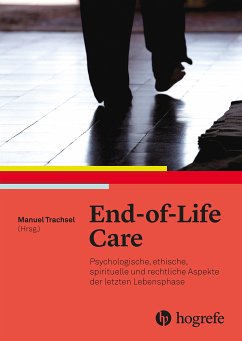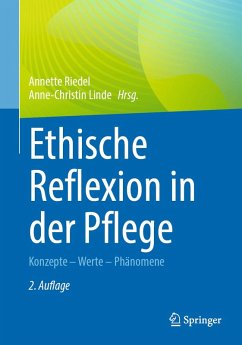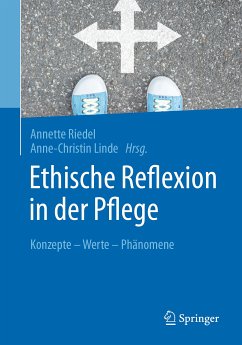Grundlagen der Medizinethik (eBook, PDF)
Sofort per Download lieferbar
Statt: 15,00 €**
9,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Broschiertes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Der Band bietet einen fundierten Überblick über die wesentlichen Fragestellungen und Argumente der aktuellen Diskussion um den Umgang mit der modernen Medizin in heutigen, pluralistischen Gesellschaften.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D ausgeliefert werden.