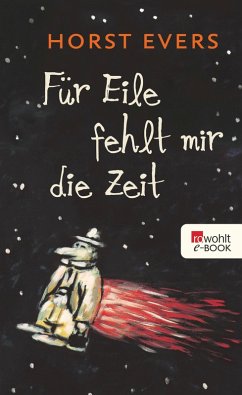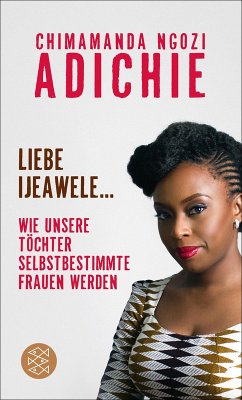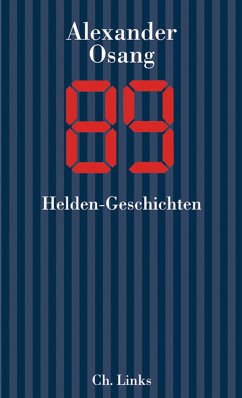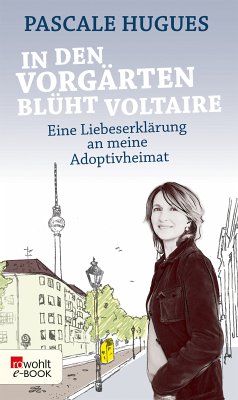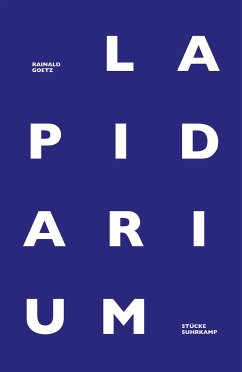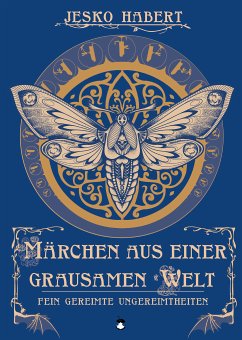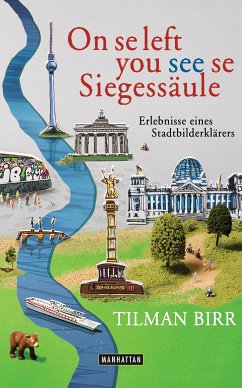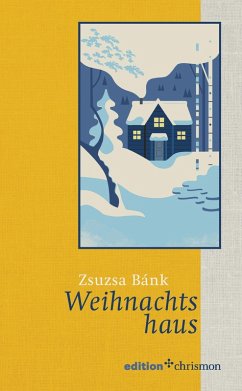Grundlagenforschung (eBook, ePUB)
Erzählungen
Sofort per Download lieferbar
Statt: 20,00 €**
12,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Schnell gehen sie vorbei, die Sekunden der Erkenntnis. Sie müssen festgehalten werden! Oder erst erzeugt anhand von Figuren, Beziehungen, außerordentlichen Begebenheiten. Das Leben ist undurchsichtig und erzählenswert. Und es gilt, in diesem Leben vorzukommen, zwischen all den Wünschen und Enttäuschungen, den gesellschaftlichen Normen und alltäglichen Herausforderungen. Wer bin ich denn hier überhaupt? Wer könnte ich sein? Die nervöse Zwanzigjährige, die hofft, dass ihr Freund anruft. Die hoffnungsvolle Dreißigjährige, die glaubt, dass bei ihr alles anders wird. Anders zumindest al...
Schnell gehen sie vorbei, die Sekunden der Erkenntnis. Sie müssen festgehalten werden! Oder erst erzeugt anhand von Figuren, Beziehungen, außerordentlichen Begebenheiten. Das Leben ist undurchsichtig und erzählenswert. Und es gilt, in diesem Leben vorzukommen, zwischen all den Wünschen und Enttäuschungen, den gesellschaftlichen Normen und alltäglichen Herausforderungen. Wer bin ich denn hier überhaupt? Wer könnte ich sein? Die nervöse Zwanzigjährige, die hofft, dass ihr Freund anruft. Die hoffnungsvolle Dreißigjährige, die glaubt, dass bei ihr alles anders wird. Anders zumindest als bei der ätzenden Ex, die doch hätte wissen müssen, dass Kinderkriegen auch keinen Ausweg darstellt. Oder bin ich vielleicht sogar die? Es ist gut, ein paar Erzählungen als Wegweiser zu haben. Für jetzt - und für später. Sag nicht, du hättest's nicht gewusst! Hier steht's doch, schwarz auf weiß, und Spaß macht es auch noch. In diesem Erzählungsband vermag man sämtliche Motive, Themen, ja geradezu die gesamte literarische Welt Anke Stellings zu entdecken - und diese Erforschung ist nicht nur für Stelling-Fans faszinierend.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.