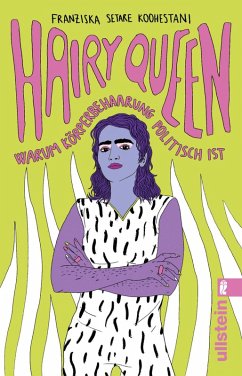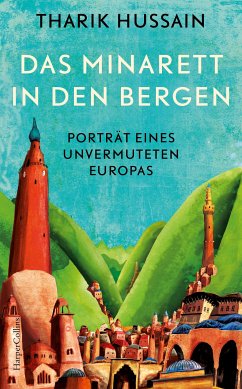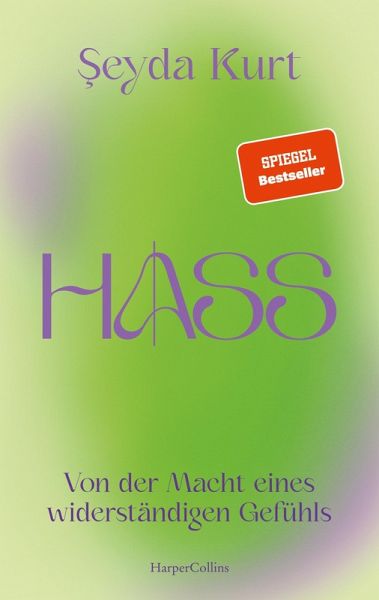
Hass. Von der Macht eines widerständigen Gefühls (eBook, ePUB)
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 18,00 €**
13,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Broschiertes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
WER HAT DIE MACHT ZU HASSEN? - Erkundung eines politischen GefühlsDer Hass, dieses knirschende, zersetzende Gefühl, ist allgegenwärtig. Er brüllt von den Straßen oder flüstert in gutbürgerlicher Feindseligkeit. Er wächst in Parlamentsreden, Querköpfen und Kinderzimmern, und ganz bestimmt nicht im Verborgenen, auch wenn viele ihn gerne dorthin verdammen würden.Seyda Kurt holt den Hass raus aus der Verbannung und begibt sich auf die Spuren seines widerständigen Potentials. Dabei interessieren sie vor allem die Menschen als die Subjekte von Hass in einer kapitalistischen, rassistischen...
WER HAT DIE MACHT ZU HASSEN? - Erkundung eines politischen Gefühls
Der Hass, dieses knirschende, zersetzende Gefühl, ist allgegenwärtig. Er brüllt von den Straßen oder flüstert in gutbürgerlicher Feindseligkeit. Er wächst in Parlamentsreden, Querköpfen und Kinderzimmern, und ganz bestimmt nicht im Verborgenen, auch wenn viele ihn gerne dorthin verdammen würden.
Seyda Kurt holt den Hass raus aus der Verbannung und begibt sich auf die Spuren seines widerständigen Potentials. Dabei interessieren sie vor allem die Menschen als die Subjekte von Hass in einer kapitalistischen, rassistischen und patriarchalen Welt. Wer sind sie, diese Hassenden, und aus welchen Machtverhältnissen kommen sie? Wer darf überhaupt hassen und wer nicht? Welche Gefühle lähmen, welche Gefühle helfen, nicht zu erstarren, und sich immer und immer weiter zu bewegen auf dem Weg in eine gerechtere und zärtliche Gesellschaft?
Schonungslos, launig und jenseits selbstgerechter Entrüstung erkundet Seyda Kurt den Hass von seiner schöpferischen Seite: als Kategorie der Ermächtigung, der Menschen in ihrem innersten Unbehagen abholen und mobilisieren kann, als widerständiges Handwerk - und nicht zuletzt als dienliches Gefühl, das uns hilft, uns in einem Ozean aus möglichen Reaktionen auf die Welt zurechtzufinden.
Der Hass, dieses knirschende, zersetzende Gefühl, ist allgegenwärtig. Er brüllt von den Straßen oder flüstert in gutbürgerlicher Feindseligkeit. Er wächst in Parlamentsreden, Querköpfen und Kinderzimmern, und ganz bestimmt nicht im Verborgenen, auch wenn viele ihn gerne dorthin verdammen würden.
Seyda Kurt holt den Hass raus aus der Verbannung und begibt sich auf die Spuren seines widerständigen Potentials. Dabei interessieren sie vor allem die Menschen als die Subjekte von Hass in einer kapitalistischen, rassistischen und patriarchalen Welt. Wer sind sie, diese Hassenden, und aus welchen Machtverhältnissen kommen sie? Wer darf überhaupt hassen und wer nicht? Welche Gefühle lähmen, welche Gefühle helfen, nicht zu erstarren, und sich immer und immer weiter zu bewegen auf dem Weg in eine gerechtere und zärtliche Gesellschaft?
Schonungslos, launig und jenseits selbstgerechter Entrüstung erkundet Seyda Kurt den Hass von seiner schöpferischen Seite: als Kategorie der Ermächtigung, der Menschen in ihrem innersten Unbehagen abholen und mobilisieren kann, als widerständiges Handwerk - und nicht zuletzt als dienliches Gefühl, das uns hilft, uns in einem Ozean aus möglichen Reaktionen auf die Welt zurechtzufinden.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.