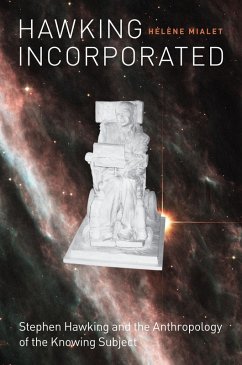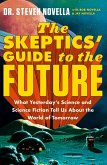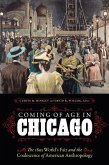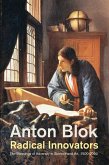Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Stephen Hawking ist Theoretischer Physiker. Nicht irgendeiner, sondern der bekannteste seines Fachs. Für diese Bekanntheit kann man den Reiz der Gegenstände ins Feld führen, die seine Theoreme verknüpfen: Kosmologische Modelle, Singularitäten, Schwarze Löcher, Entropie - was sich die Physik bei Beschwörungen letzter Fragen über das große Ganze eben so leistet. Und weil man nicht ohne weiteres zu einem Lehrstuhl in Cambridge kommt, den einst Newton innehatte, muss an den Theoremen ja auch was dran sein.
Was freilich nicht heißt, dass der Laie über den Schauer abgründiger Vermutungen hinaus besonders viel mit ihnen anzufangen wüsste. Aber wohl schon mit dem Verhältnis zwischen dem Ausgreifen auf letzte Fragen nach dem Universum und der physischen Eingeschränktheit des Theoretikers, der solche Leistung gerade deshalb verkörpert, weil er durch seine Krankheit, die ihn mittlerweile fast vollständig gelähmt hat, in gewisser Weise körperlos geworden ist.
Nun ist der Hinweis auf die mediale Wirkung des "entkörperten" Theoretikers, der es als reiner Geist mit den "Geheimnissen des Universums" aufnimmt - also mit den Geheimnissen eines anderen reinen Geists, nämlich des Schöpfers -, nicht unbedingt originell. Dafür liegt er zu sehr auf der Hand. Aber es lohnt doch, sich diesen Effekt etwas näher anzusehen und dem "Phänomen Hawking" bis in die feineren Verästelungen nachzugehen. Ein gerade erschienenes Buch der Wissenschaftssoziologin Hélène Mialet führt das schön vor Augen (Hélène Mialet: "Hawking Incorporated". Stephen Hawking and the Anthropology of the Knowing Subject. The University of Chicago Press, Chicago and London 2012. 266 S., Abb., br., 26,- [Euro]).
Der Titel mag zuerst überraschen: Warum sollte man gerade an den sehr speziellen Fall Hawking eine Anthropologie wissenschaftlicher Erkenntnis knüpfen können? Mialets Antwort lautet: Weil das Phänomen Hawking eine populäre Vorstellung vom auf sich gestellten genialen Theoretiker wie unter einem Vergrößerungsglas zu betrachten gestattet. Mialet zeigt, wie das öffentliche Image des nur in seinem Geist den tiefen Fragen nachspürenden Physikers stabilisiert wird. Und sie macht gleichzeitig klar, dass dieses Image nur Bestand hat, weil ausgeblendet wird, wie dieser Geist des Physikers tatsächlich beständig verkörpert wird: in den raffinierten technischen Erweiterungen seiner Existenz, in der von ihm benutzten Software, im Kollektiv der ihm zuarbeitenden Assistenten, in wissenschaftlichen Netzwerken und medialen Aufbereitungen.
Die Pointe dieser soziologischen Feldforschung auf dem Terrain einer mit denkbar abstrakten Objekten beschäftigten Disziplin ist: Gerade dort, wo die Urzeugung dieser Objekte im Kopf des Theoretikers zelebriert wird, genau dort lässt sich mit Effekt zeigen, wie viele vermittelnde Instanzen tatsächlich ins Spiel kommen. Die Anmerkung, dass sie damit ein ohnehin schon angestaubtes Bild der Wissenschaft revidiere, muss Hélène Mialet nicht rühren: Das Phänomen Hawking zeigt, dass es auf diesem Gebiet noch etwas zu entzaubern gibt.
HELMUT MAYER
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main