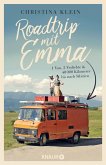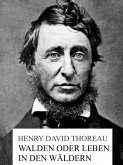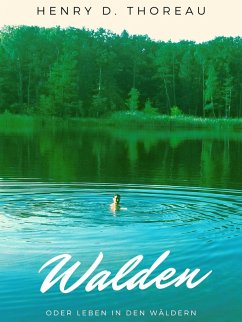Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Eigenauswilderung: Wolfgang Büscher nimmt ein langes literarisches Waldbad und findet Heimat, mit allem, was dazugehört.
Es ist eine Metamorphose von Ovidscher Dimension: Der deutsche Wald, seit Tacitus ein Begriff und seit den Romantikern märchenhafter Sehnsuchtsort der Teutonenseele, verwandelt sich in Waldbücher. Bäume in Papier. So viele von ihnen sind in jüngerer Zeit erschienen, dass man wie Hänsel oder Gretel dazwischen verlorengehen kann. Es ist, als wollten wir dem leidenden Forst, der den sauren Regen überstanden hat, aber dem Klimawandel hilflos ausgeliefert ist, wenigstens symbolisch eine neue Heimat anbieten, das städtische Bücherregal aufforsten gewissermaßen.
Ein weiteres Buch kommt nun hinzu, und sicher keines, das zum Unterholz gehört. Dabei sind auch Aussteigerbücher keineswegs neu. Und was der Grenzgänger Wolfgang Büscher mit "Heimkehr" vorlegt, ist durchaus eine Liebeserklärung an die Natur und eine neuerliche Eloge auf Ludwig Tiecks "Waldeinsamkeit", aber ohne alle falsche Romantik. Dafür ist der Autor ein viel zu guter Beobachter, Denker und Stilist. Er registriert mit wachem Blick, wo das Uralte ins Hier und Heute hinüberwurzelt, wo sich die Moderne der Vorwelt noch bewusst ist: im dörflichen Lebenszyklus, bei der Jagd, zumal der adeligen, in der Forstwirtschaft. Das geht gut zusammen mit einer kindlichen Bewunderung für die "Harvester" genannten Riesenmaschinen ("Urweltwesen"), die im dichtesten Wald Bäume ernten und entasten, als wären es Stöckchen. Allerdings kommen sie den Sturm- und Käferschäden kaum noch hinterher: Das Zusammenleben mit dem Wald, das abseits der Städte erstaunlich konstant geblieben ist und einen ganzen Menschenschlag prägt, es scheint nun doch in Gefahr.
Auf dieses Zusammenleben kommt es Büscher an. Wo Peter Wohlleben, der Förster unter den Schriftstellern, an einer sich immer weiter verzweigenden Waldpsychologie arbeitet, legt Wolfgang Büscher, der Wanderer unter den Schriftstellern, so etwas wie eine empirische Waldsoziologie vor, eine Waldleben-Innenbetrachtung, zu deren Behuf er die eigene Auswilderung betrieben hat. Damit stellt er sich, auch wenn der Name nicht ein einziges Mal fällt, bewusst in die Tradition von Henry David Thoreau. 170 Jahre nach dem Weltbuch "Walden" bezieht auch Büscher ganz asketisch eine Hütte im (nordhessischen Waldecker) Wald, die er, anders als Thoreau, aber nicht selbst gezimmert hat, sondern von einem großzügigen, namentlich ungenannten "Erbprinzen" (es muss Carl Anton Prinz zu Waldeck und Pyrmont sein) gestellt bekam.
Zwar gibt es auch bei Büscher die Reflexionen eines "Waldfreien" an stillen Abenden - mit die schönsten, tiefsten Passagen des Buches: "Leben und Tod, wie fassbar war das hier draußen, und wie selbstredend das Jahrmaß" -, aber auf ein Eremitendasein hat es der Autor nicht abgesehen, schon gar nicht zum Ergrübeln eines philosophischen Manifests des einfachen Lebens. Die Jagdhütte entbirgt sich ihm vielmehr als sozialer Ort, eng verbunden mit ihrer Umgebung: mit dem ehemaligen Fürstenhaus, mit dem Förster des Reviers (angesichts dieses Wald-Meisters gerät Büscher ins Schwärmen), mit Jagdgesellschaften oder diversen Waldarbeitern. Sogar der Bonifatiusweg führt an der Hütte entlang, auch wenn ihn, eine der ersten vom Förster vermittelten Erkenntnisse, so gut wie niemand aufsuche: "Der Wald sei menschenleer, jedenfalls seiner. Er habe keine Rundwege für Sonntagsspaziergänger zu bieten." Und doch ist man im Wald, dem verschwenderischen, nie wirklich allein; er steht geradezu für das Gegenteil von Einsamkeit, wie sie in leeren Zimmern wohnt.
Für Büscher ist die Hütte Ausgangspunkt seiner Wanderungen: in die Dörfer der Umgebung, wo er in großer Zugewandtheit ein Schützenfest besucht, bei dem alle bis hinauf zum "König" ein Stück weit in ihre Rollen hineinzuwachsen scheinen, zur Residenzstadt Bad Arolsen, die sich einen Rest von aristokratischer Noblesse bewahrt hat, in den Totenwald, wo er über den gewaltigen Bruch sinniert, den das fast spurlose Verschwindenwollen gegenüber den Begräbnisritualen der vergangenen Jahrtausende darstellt. Immer wieder durchstreift er mit dem Förster den Wald, mit dem Fürsten geht er voller Begeisterung auf die Jagd, auf Hochsitzen beobachtet er die ihm witterungstechnisch unendlich überlegenen Tiere, deren Heimat für ein Dreivierteljahr auch die seine ist.
Der Wald, mächtig, wenngleich verletzlich, behandelt alle Bewohner gleich. Demokratisch ist das aber noch lange nicht, wie der Autor zeigt, indem er die jüngere Vorgeschichte des ihn so herzlich aufnehmenden und sich dieses "Schattens" sehr bewussten Fürstenhauses aufarbeitet: Der Großvater des jungen Erbprinzen war Josias zu Waldeck und Pyrmont, SS-Obergruppenführer, General der Waffen-SS und einer der engsten Vertrauten von Heinrich Himmler. "Dafür kann der Wald nichts", sagt der Förster ganz richtig, aber er kann es auch nicht verschwinden lassen. Vielmehr verwächst alle Historie mit dem Forst, der schließlich kein "menschenferner Urwald" sei: "Etwas Altes war um die Höhen mit ihren knorzigen Namen, in denen ein Kult nachhallte, ein kurioses oder ein grausiges Ereignis." Der Wald bewahrt alles auf, Helles wie Dunkles, für den, der es sehen will.
Eine "Heimkehr" ist das auf verschiedenen Ebenen. So kehrt der als junger Mann in die Welt gezogene Autor hier in seine Kindheitsregion zurück, sucht das verlassene Elternhaus auf und erinnert sich an seinen rebellischen Ausbruch aus der Tradition. Er hält der sterbenden Mutter im Hospiz die Hand - "Heimkehr" ist auch ein Abschiedsbuch -, und da öffnet sich der Text ein Stück weit ins Metaphysische, handelt von der Heimkehr in die ewige Ruhe, die im Wald kein prätentiöses Konzept ist, sondern tröstliche, erdige Alltäglichkeit. Der Kreislauf aus Welken und Erblühen wird auch, so die leise Hoffnung des Autors wie des Försters (und, eher kulturkritisch, schon Thoreaus), den großen Umbruch überstehen, den Abschied von den Fichtenbeständen, das Austrocknen der Böden, das Insektensterben und so fort. Wolfgang Büscher porträtiert das Leben mit dem und durch den und für den Forst sensibel und genau. Das hat nichts von Naturpoesie. Vielmehr nimmt hier ein Schreibender all seine Formulierungskünste her, um unserem Wald in großem Respekt seine Aufwartung zu machen: Näher kommt ein Bücherregal an seine Urahnen nicht heran.
OLIVER JUNGEN
Wolfgang Büscher: "Heimkehr".
Rowohlt Berlin Verlag, Berlin 2020. 208 S., geb., 22,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH