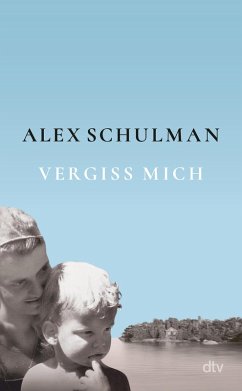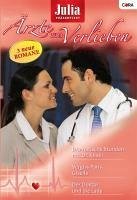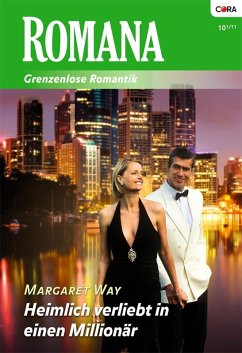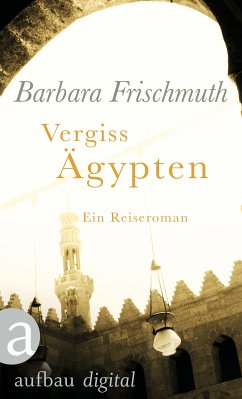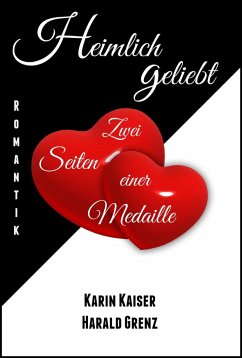Heimlich, heimlich mich vergiss (eBook, ePUB)
Roman
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 25,00 €**
19,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
In ortloser Höhe thront eine gläserne Klinik über den Angelegenheiten der Normalsterblichen. Dr. Franz von Stern, der als Arzt selbstverständlich mit einer zusätzlichen Hirnrindenschicht und einem Mediator zwischen den Rippen ausgestattet ist, versagt als Referent in eigener Sache: Unfähig, den geforderten Eigenbericht für seine Klinikleitung zu verfassen, erzählt er sich zurück in seine Vergangenheit. Eine "Ambulante" erscheint ihm als Wiedergängerin seiner Frau, und im vermeintlichen Wahngerede seiner Patienten sucht er nach dem Echo der eigenen Geschichte. Irrealer als die Gegenwa...
In ortloser Höhe thront eine gläserne Klinik über den Angelegenheiten der Normalsterblichen. Dr. Franz von Stern, der als Arzt selbstverständlich mit einer zusätzlichen Hirnrindenschicht und einem Mediator zwischen den Rippen ausgestattet ist, versagt als Referent in eigener Sache: Unfähig, den geforderten Eigenbericht für seine Klinikleitung zu verfassen, erzählt er sich zurück in seine Vergangenheit. Eine "Ambulante" erscheint ihm als Wiedergängerin seiner Frau, und im vermeintlichen Wahngerede seiner Patienten sucht er nach dem Echo der eigenen Geschichte. Irrealer als die Gegenwart, dieses taghelle Delirium, kann das Erinnerte nicht sein, und so macht von Stern sich auf, seine verglaste Welt zu verlassen.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.