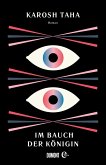Alma und Friedrich bekommen ein Kind, das keinen Schmerz empfinden kann. In ständiger Sorge um ihren Jungen kontrolliert Alma unaufhörlich seine körperliche Unversehrtheit. Halt findet Alma bei ihrer hochbetagten Großmutter, die nach lebenslangem Schweigen zu erzählen beginnt: vom Krieg, von Flucht, Hunger und Entbehrungen. Mit dem Kind auf dem Schoß, das keinen Schmerz kennt, sitzt Alma am Bett der alten Frau, die sich nichts mehr wünscht, als ihren Schmerz zu überwinden. Und in den Geschichten der Großmutter findet sie eine Erklärung für jene Gefühle der Schuld, der Ohnmacht und der Verlorenheit, die sie ihr Leben lang begleiten.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, I ausgeliefert werden.

Vom Schmerz erzählen? Valerie Fritschs Roman "Herzklappen von Johnson & Johnson"
Mit der Erzählkunst sei es endgültig zu Ende, schrieb Walter Benjamin 1936, weil sich nach dem ersten Weltkrieg die Erfahrungsqualität so drastisch verändert habe, dass den Zeugen nur das Schweigen übrig blieb. Ob die österreichische Autorin und Fotokünstlerin Valerie Fritsch Benjamin gelesen hat, darüber kann nur spekuliert werden. Dennoch: Wollte man Benjamins melancholischen Blick auf den Verlust der Mitteilbarkeit von Erfahrung in eine literarische Form gießen, käme vielleicht ein Roman wie "Herzklappen von Johnson & Johnson" dabei heraus.
Dem Personal nach handelt es sich um einen klassischen Familienroman. Da ist der Großvater, der erst den Zweiten Weltkrieg als Soldat, dann die Lagerhaft, wie er meint, nur durch Zufall überlebt hat und der fortan jeden Tag unter dem Auserwähltsein leiden wird. Da ist die Großmutter, die seinem Schweigen einen Reigen an "Stell dir vor"-Geschichten entgegensetzt und in deren Wohnung Zeit und Aufmerksamkeit einer anderen Ordnung gehorchen. Da ist die Mutter, penible Matriarchin in einem klinisch sauberen Zuhause, "in dem sie jeden Dienstag die Regale abstaubte, bevor die Putzfrau jeden Mittwoch kam". Und da ist, im Zentrum des Romans, Alma, die Tochter, eine Kinderbuchillustratorin, die in Momenten zu großer Emotionalität Zitronenbonbons lutscht und die Beine anzieht.
Dieser Hauptfigur ist auch der glückliche Umstand zu verdanken, dass schon nach wenigen Seiten feststeht, dass die Geschichte weniger ein klassischer Familienroman als eine fein gestrickte Parabel auf den Schmerz ist. Alma ist eine kurios dem Leben entrückte Person, der die Erzählstimme des Romans so nah auf den Fersen folgt, dass man manchmal ganz in ihrer Sinnlichkeit versinkt. Ihre Kindheit wird durch das elterliche Schweigen regiert, das vielleicht über das Trauma des Großvaters in die Familie einzog, vielleicht aber auch schon vorher da war. So genau erfährt man es nicht, denn die Geschichte hält sich vom Pathologisieren glücklicherweise fern. Jedenfalls war ihr kindliches Zuhause derart still, dass Alma dachte, wenn das Telefon klingelte, "es läutete im eigenen Kopf". Dazu passt, dass ihr das Umfeld "mitunter beängstigend kulissenhaft" scheint, "brüchig zusammengezimmert", wie ein schlechtes Theaterstück, eigens für sie aufgeführt.
Die Einzige, die noch sprechen mag, ist Almas Großmutter. In ihrem "Hinterzimmeruniversum der Zeit" erzählt sie Erinnerungen aus einer Welt, in der Worte wie "Ausgeliefertsein", "Kannibalismus" und "Einsamkeit", leise geraunt, auf Schicksale vor der eigenen Haustür bezogen waren. Weil sie den Menschen nicht mehr traut, bleibt sie in besserer Gesellschaft allein mit den Dingen in ihrer Wohnung, die ihr wie Freunde geworden sind. Und weil sie diese Wohnung so gut kennt, findet sie auch mit geschlossenen Augen den Weg zum stets gepackten Koffer im Schlafzimmer.
Alma studiert, wie die Sprache ihrer Familie vom Schmerz durchzogen ist. Wie die einen nicht mehr, die anderen zu viel reden, und sie lernt, den Alltag mitzusprechen. Dann bekommt sie einen Sohn, der eine seltene Krankheit hat: Emils Schmerzrezeptoren sind aufgrund eines Gendefekts lahmgelegt, er kann keine Schmerzen fühlen. Eine Kindheit ohne Schmerz bedeutet eine Kindheit im Krankenhaus. Kein warnendes Gefühl, das Blinddarmentzündungen oder Knochenbrüche anzeigt, kein somatischer Selbstschutz vor den anderen Kindern, die den Körper des Jungen als Experimentierfeld der Mutproben und anatomischen Erforschungen nutzen, und vor den Verwandten, die stets eine Spur zu grob an ihm herumzupfen, um zu sehen, ob er nicht doch etwas fühlt. Was dem Jungen nicht gegeben ist, muss Alma ersetzen. Nach jedem Spiel kontrolliert sie seinen Körper auf Prellungen und Wunden oder misst seine Temperatur.
Doch Schmerz ist weit mehr als ein Warnsystem der Vitalfunktionen. Als omnipräsente Metapher strukturieren Krankheit und Schmerz die menschliche Mitteilung, sind Maßstab und Richtwert jedweder Empathiebekundung. Kein Liebeskummer ohne Herzweh, keine Traurigkeit ohne enge Brust. Was eine nüchterne Diagnose sein könnte, wird bei Fritsch zur Poetik eines Defekts, der auch die Sprache befällt. Es war, so heißt es über Emil, "als litte er an einer Körpersprachlosigkeit, die zu den schlimmsten Dingen schwieg. Zu dem Wissen, das jedem Schmerz innewohnt, hatte er keinen Zugang." Alma, die gelernt hat, dem Schweigen des Großvaters und der Beredsamkeit der Großmutter zu lauschen, beginnt, ihrem Sohn den Schmerz zu erklären, errichtet ein sprachliches "Stellvertreterweh".
Was Walter Benjamin einst über den Zivilisationseinschnitt des Kriegs konstatierte, nämlich die aus ihm folgende Unfähigkeit, Erfahrung in Worte zu bringen, ist Hausgesetz in Almas Familie. Die einen reden nicht, weil der Schmerz zu groß ist, der Körperstumme aber benötigt die Sprache, um den Schmerz zu begreifen. Dass physisch und psychisch bedingtes Schweigen in dieser Familie so nahtlos zusammenlaufen, ist eine zugespitzte Metapher, medizinisch wäre die Engführung ein Fass ohne Boden. Doch gerade diese unerklärliche Verbindung erzeugt Almas tiefe Ratlosigkeit. Ihre Sehnsucht nach einer eindeutigen Familienerzählung kann sich nicht erfüllen, es gibt "kein Zeichen, kein erlösendes Gefühl, kein Ende der Geschichte".
Valerie Fritsch hat ein wundersam stilles Büchlein über die Spuren geschrieben, die ein allzu großer und auch ein fehlender Schmerz in einer Familie hinterlassen. Stimmigerweise hat die Geschichte kein eindeutiges Thema, sondern wandert von Motiv zu Motiv, ohne dass ihnen schwere Bedeutsamkeit aufgezwungen würde. Das erinnert in poetologischer Hinsicht an den frühen Peter Handke. Wie stark der Leseeindruck sein kann, wenn alles "kein Hinweis auf etwas andres mehr" ("Die Stunde der wahren Empfindung") ist, sondern nur für sich selbst stehen darf, ist auch bei Fritsch zu spüren. Ihr Stil ist ähnlich geprägt von einer begrifflichen Vagheit, einer semiotisch grundierten Scheu vor dem konkreten Benennen. Deshalb sind ihre Beobachtungen so zärtlich-leise wie ausschweifend. Kein heilsames Buch. Aber eines, das zielsicher von der Schwierigkeit der Weitergabe und des Teilens von Erfahrung zwischen den Generationen erzählt.
MIRYAM SCHELLBACH.
Valerie Fritsch: "Herzklappen von Johnson & Johnson". Roman.
Suhrkamp Verlag, Berlin 2020. 174 S., geb., 22,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH