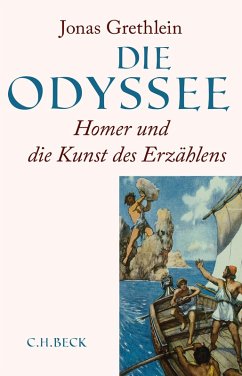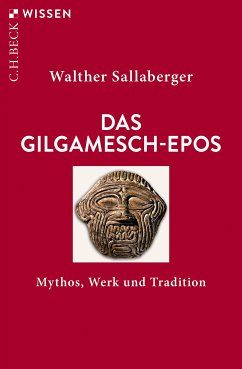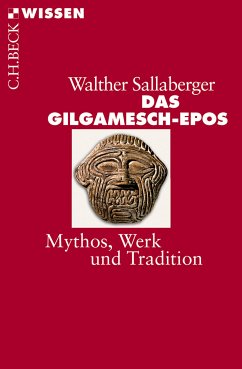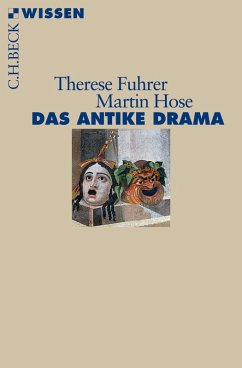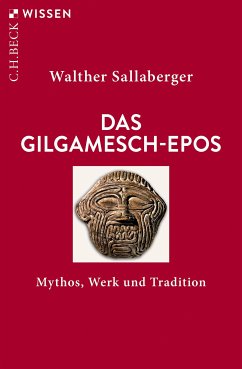Homer (eBook, ePUB)
oder Die Geburt der abendländischen Dichtung
Sofort per Download lieferbar
Statt: 24,95 €**
18,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Um wieviel ärmer wäre die Weltliteratur, hätte uns Homer nicht Ilias und Odyssee geschenkt. Ohne seine Helden, die mit Todesverachtung vor Troia für Liebe und Ehre kämpfen oder sich allen Fährnissen zum Trotz standhaft um die Heimkehr mühen, wüßten wir nichts vom Zorn des Achill und von der Tapferkeit Hektors, nichts von der verführerischen Anmut Helenas und nichts vom Listenreichtum des Odysseus. Auch hat kein anderes Werk auf die Literaturauffassung, Literaturgestaltung und Literaturtheorie anderer Epochen einen solchen Einfluß gehabt wie die Ilias auf die literarischen Traditione...
Um wieviel ärmer wäre die Weltliteratur, hätte uns Homer nicht Ilias und Odyssee geschenkt. Ohne seine Helden, die mit Todesverachtung vor Troia für Liebe und Ehre kämpfen oder sich allen Fährnissen zum Trotz standhaft um die Heimkehr mühen, wüßten wir nichts vom Zorn des Achill und von der Tapferkeit Hektors, nichts von der verführerischen Anmut Helenas und nichts vom Listenreichtum des Odysseus. Auch hat kein anderes Werk auf die Literaturauffassung, Literaturgestaltung und Literaturtheorie anderer Epochen einen solchen Einfluß gehabt wie die Ilias auf die literarischen Traditionen Europas bis ins 19.Jahrhundert. In diesem Sinne kann man in der Ilias ¿die Geburt der abendländischen Dichtung¿ sehen, in der Odyssee bereits den Beginn der von der Ilias bestimmten ¿Tradition¿. Daß aber diese Wirkungsmacht überhaupt entfaltet werden konnte, liegt in dem Kunstreichtum des Dichters begründet ¿ in der Meisterschaft seiner Komposition, der Eleganz seiner Sprache, der Wucht seines Versmaßes, der Glaubwürdigkeit seiner Charaktere. So schildert Homer eine Welt, die uns auch aus einer jahrtausendeweiten Distanz immer noch kohärent und überzeugend scheint. Dabei erzählt er großartige Geschichten von Göttern und Helden, von Himmel und Hades, von heroischer Tapferkeit und elender Feigheit oder von Edelmut und menschlichen Abgründen, die auch uns Heutige immer noch zu fesseln vermögen, so wie sie wohl einst die Zeitgenossen des Dichters in Bann schlugen. Doch so nah und verständlich uns manche Handlung und manches Gefühl in dem einen Gesang der Epen scheint, so fremd und verstörend muten sie uns in einem anderen an. All jenen, die die Werke Homers kennen- und verstehen lernen oder mehr noch als bisher mit ihnen vertraut werden wollen, öffnet Thomas A. Szlezák mit diesem Buch einen Zugang zur Welt des Dichters. Dabei erläutert er gleichermaßen anregend und verständlich Wesenszüge und Besonderheiten seiner Dichtkunst, skizziert den Gang der Ereignisse in seinen Werken, beschreibt die Gesellschaften, denen seine Protagonisten entstammen, und erhellt deren Weltbilder und Geisteshaltung sowie die Grundzüge ihrer Konflikte. Schließlich fragt er nach der Bedeutung der homerischen Epen und nach den Verbindungslinien, die sich zu altorientalischen Traditionen finden lassen.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.