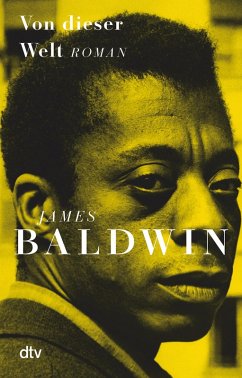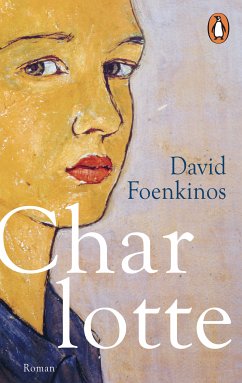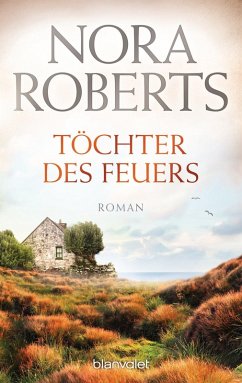I Love Dick (eBook, ePUB)

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Chris Kraus, eine gescheiterte Künstlerin, die unaufhaltsam auf die 40 zugeht, lernt durch ihren Ehemann den akademischen Cowboy Dick kennen. Dick wird zu ihrer Obsession. Völlig überwältigt von ihren Gefühlen schreibt sie zunächst eine Erzählung über ihr erstes Treffen, dann verfasst sie Briefe, die sie nicht abschickt, und auch Sylvère, ihr Mann, wird Teil dieses Konzept-Dreiers. Mal schreiben beide Dick gemeinsam, mal einzeln, doch während Sylvère irgendwann sein Interesse wieder verliert, verstrickt sich Chris immer mehr in die Abgründe ihrer eigenen Begierde. Chris Kraus hebt ...
Chris Kraus, eine gescheiterte Künstlerin, die unaufhaltsam auf die 40 zugeht, lernt durch ihren Ehemann den akademischen Cowboy Dick kennen. Dick wird zu ihrer Obsession. Völlig überwältigt von ihren Gefühlen schreibt sie zunächst eine Erzählung über ihr erstes Treffen, dann verfasst sie Briefe, die sie nicht abschickt, und auch Sylvère, ihr Mann, wird Teil dieses Konzept-Dreiers. Mal schreiben beide Dick gemeinsam, mal einzeln, doch während Sylvère irgendwann sein Interesse wieder verliert, verstrickt sich Chris immer mehr in die Abgründe ihrer eigenen Begierde. Chris Kraus hebt in ihrem mittlerweile in mehr als ein Dutzend Sprachen übersetzten und als Amazon-Serie verfilmten Roman die Grenzen zwischen Fiktion, Essay und Tagebuch auf und schuf damit gegen Ende des 20. Jahrhunderts ein völlig neues Genre. Was die Autorin selbst als "Bekenntnis- Literatur" und "Phänomenologie der einsamen Mädchen" bezeichnet, ist weit mehr als das : Es ist der letzte große feministische Roman des 20. und der erste große Liebesroman des 21. Jahrhunderts.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.