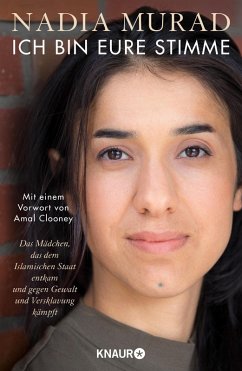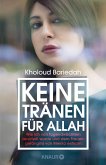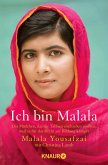Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Dschihad und Kalifat: Nadia Murad berichtet von der Auslöschung der Jesiden, die Konvertitin Maryam A. von ihrer Zeit beim "Islamischen Staat"
Vom Dach des Lehmhauses, in dem Nadia Murad aufwuchs, sieht sie am 3. August 2014 vor Sonnenaufgang, wie sich ein Konvoi von Lastwagen des "Islamischen Staates" (IS) auf Kocho zubewegt. Die Männer kommen, um Murads Leben zu zerstören. Hunderte der Bewohner in dem jesidischen Ort zwischen Euphrat und Tigris werden sie ermorden. Nur Erinnerungen an ihre Heimat sind der Überlebenden Murad geblieben - an die Familie, den Duft der Gewürze in der Küche und an die blökenden Schafe auf den umliegenden Wiesen.
Heute ist Nadia Murad die erste Sonderbotschafterin der Vereinten Nationen für die Würde der Überlebenden von Menschenhandel. In dem Buch "Ich bin eure Stimme" schildert sie den perfiden Angriff auf die jesidische Minderheit. Kocho, unweit des Höhenzugs Dschabal Sindschar gelegen, riegeln die IS-Kämpfer gleich nach der Eroberung ab. Wenige Tage später zwingen sie die Bewohner, sich auf dem Schulhof zu versammeln. "Das Haus meines Vaters ist zerstört", hört Murad ihre Mutter ein altes jesidisches Sprichwort sagen, als die Gewehrsalven zu dröhnen beginnen und die Dschihadisten die Männer aus dem Dorf erschießen. Sechs von Murads Brüdern kommen bei den Massakern um. Sie werden in Massengräbern verscharrt.
Andernorts im Zweistromland gehen die Dschihadisten ähnlich vor. Die Schilderungen der jungen Jesidin, die die Journalistin Jenna Krajeski protokolliert hat, bieten einem breiten Publikum aussagekräftige Eindrücke von den abscheulichen Kriegsverbrechen des IS. Was Murad erlebte, spricht dafür, dass der IS in zerstörerischer Absicht gehandelt, einen Genozid verübt hat. Tausende Jesiden sind ausgelöscht worden. Eine Untersuchungskommission hat die Hetzjagd in einem Gutachten für den UN-Menschenrechtsrat als Völkermord qualifiziert.
Im weiteren Verlauf der Säuberungsaktionen wird Murad von ihrer Mutter getrennt. Bei einem Massaker an älteren jesidischen Frauen kommt diese um. Zusammen mit anderen jungen Jesidinnen aus Kocho verschleppen die IS-Kämpfer Murad in einem Bus nach Mossul. "Sabaya" nennen die Islamisten sie fortan - als Sexsklavin wird sie an fremde Männer verkauft. Tausende junge Jesidinnen erleiden das gleiche Schicksal. Gott erlaube, mit den Jesiden zu machen, was immer man wolle, weil sie keine Leute des Buches (Ahl al-kitab) seien, bekommt Murad von einem Peiniger gesagt. Es ist ein Richter, der sich in den Dienst des IS stellte, als die staatliche Ordnung Irak zerfiel.
Murad wurde monatelang gequält, gefoltert und vergewaltigt. In ihrem Buch verschweigt sie nicht, wie brutal höhere irakische Beamte und hohe Militärs vorgingen, mit welcher Akribie der IS das System verwaltete und sicherstellte, dass es für die jungen Frauen kein Entkommen gibt. Schon bevor der IS in Mesopotamien zu wüten begann, waren die Jesiden unter Muslimen verhasst. Bis heute werden sie von vielen als Teufelsanbeter verachtet, weil sich der Engel Melek Taus, zu dem sie beten, einmal einer Weisung Gottes widersetzt hat.
Nach jesidischem Glauben unterzog Gott den Stellvertreter auf Erden dabei aber nur einer Prüfung: Der Befehl hätte von Gottes Geboten fortgeführt, was der Engel erkannte, weswegen er die Weisung nicht beachtete und die Prüfung bestand. Trotzdem werden Jesiden dafür verunglimpft. Dreiundsiebzig Verfolgungswellen sind in ihr kulturelles Gedächtnis eingeschrieben. Heute ist ihre Zukunft im Zweistromland ungewisser denn je.
"Ich bin eure Stimme" ist deshalb ein wichtiger Weckruf. Wer von Murads Geschichte erfährt, wird sich dem im Vorwort formulierten Appell der Menschenrechtsanwältin Amal Clooney anschließen, dem zufolge die Staatengemeinschaft dafür zu sorgen habe, dass die Verbrechen der Dschihadisten an der jesidischen Minderheit verfolgt und geahndet werden, denn sie sind unverändert dem Hass religiöser Eiferer ausgesetzt.
Aus der Perspektive der Dschihadisten des IS nähert sich der Journalist Christoph Reuter dem Geschehen in Syrien. In dem Buch "Mein Leben im Kalifat" hat er die Geschichte einer Frankfurter Salafistin aufgeschrieben, die sich radikalisiert und anschließend für ein Leben mit ihrem Ehemann im IS-Kalifat entscheidet. Während der Mann sich unter dem Eindruck sadistischer und kriegspropagandistischer Videos an der Waffe ausbilden lässt und in den Heiligen Krieg zieht, besorgt die Konvertitin den Haushalt. Über Whatsapp tauscht sie sich mit anderen Ehefrauen von Dschihadisten aus. Zusammen amüsieren sie sich darüber, dass der IS junge Jesidinnen im Internet zum Verkauf anbietet und mit Fotos von den Sexsklavinnen in Inseraten für sie wirbt.
In "Mein Leben im Kalifat" bekommt der Leser Einblicke in das Leben einer schlichten, dem eigenen Dasein gegenüber gleichgültig eingestellten jungen Frau. Die für sie ungünstigen Folgen der Entscheidung, dem naiven, für IS-Propaganda empfänglichen Ehemann ins Kriegsgebiet zu folgen, erahnt sie wohl. Sie nimmt diese aber offenbar in Kauf. Nach kurzer Zeit will sie dem Kalifat wieder entkommen. Ihr Mann aber bleibt zurück, sie selbst wird zur Flüchtigen. Reuter beschreibt anschaulich, wie sich ein unbeständiger Mensch mit haarsträubender Leichtfertigkeit seiner Zukunftsperspektiven beraubt.
MATTHIAS HERTLE
Nadia Murad: "Ich bin eure Stimme".
Aus dem Englischen von Ulrike Becker, Jochen Schwarzer und Thomas Wollermann. Droemer Knaur Verlag, München 2017. 376 S., geb., 19,99 [Euro].
Christoph Reuter und
Maryam A.: "Mein Leben im Kalifat". Eine deutsche IS-Aussteigerin erzählt.
Deutsche Verlags-Anstalt, München 2017.
256 S., br., 18,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main