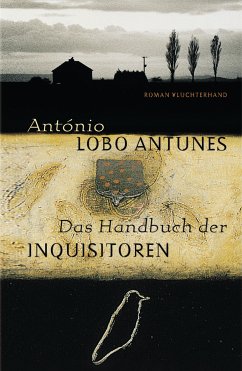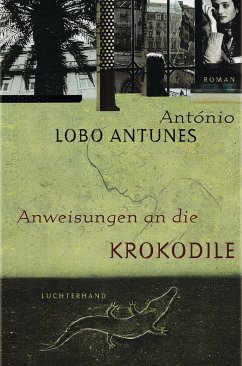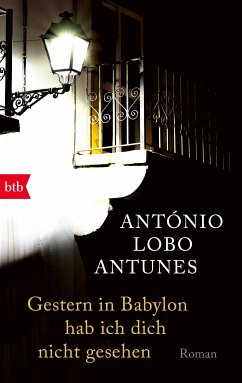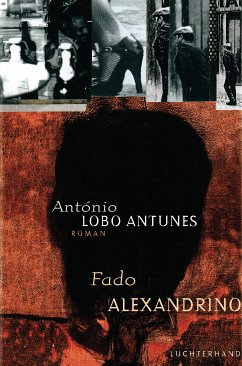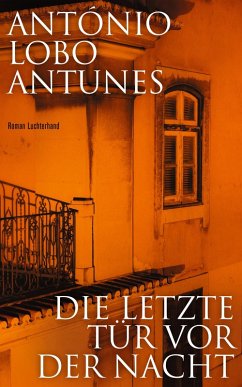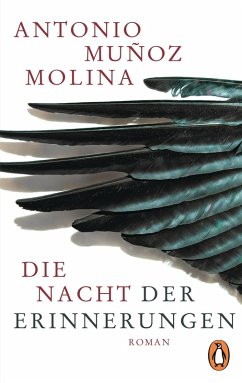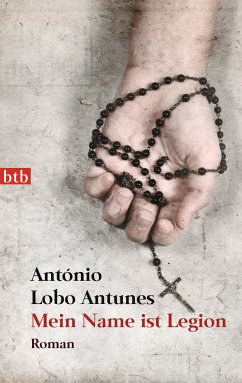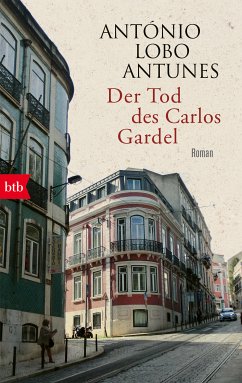Ich gehe wie ein Haus in Flammen (eBook, ePUB)
Roman
Übersetzer: Meyer-Minnemann, Maralde
Sofort per Download lieferbar
Statt: 24,00 €**
18,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Der neue Roman des Weltliteraten aus Portugal ist ein Glanzstück der polyphonen Stimmenführung. Alle Mieter eines ganz normalen Wohnhauses in Lissabon kommen hier zu Wort, erzählen aus ihrem Leben, von ihrer Vergangenheit, ihren Sehnsüchten und Ängsten. Sie kommen aus Portugal, Afrika oder der Ukraine, sie sind jung oder alt, einsam oder krank oder wütend, und sie wissen wenig voneinander. Was sie eint, ist die verzweifelte Suche nach Sinn, nach Wärme, nach Liebe.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.