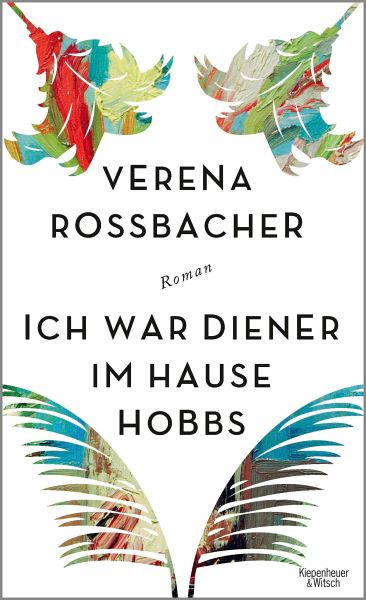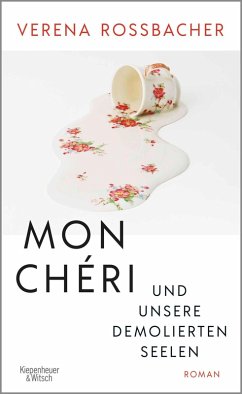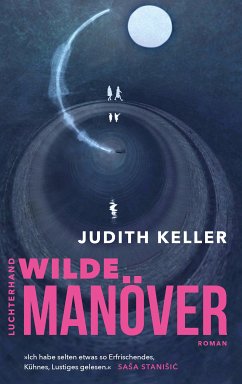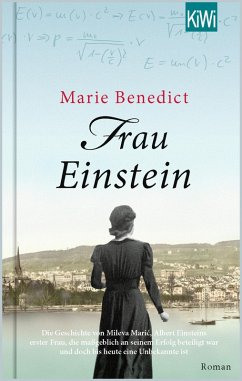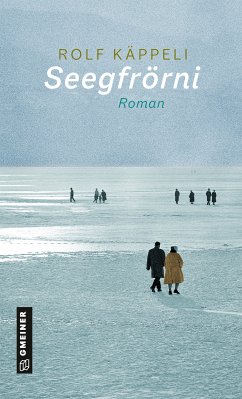Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 24,00 €**
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!






»Es war ein schlampiger Tag. Dies ist eine einfache Geschichte.« Ein Skandal und ein überraschender Todesfall in den besten Kreisen der Zürcher Gesellschaft. Ein junger Diener, der Jahre später zurückblickt und die Bruchstücke der Geschichte neu zusammensetzt. Der dritte Roman von Verena Roßbacher ist ein literarisches Ereignis - voller psychologischer Brillanz, umwerfender Poesie und doppelbödigem Humor. Es war Christian, der Diener der Zürcher Anwaltsfamilie Hobbs, der den Toten im Gartenpavillon neben der blutbespritzten Chaiselongue fand. Jahre später blickt er zurück und versu...
»Es war ein schlampiger Tag. Dies ist eine einfache Geschichte.« Ein Skandal und ein überraschender Todesfall in den besten Kreisen der Zürcher Gesellschaft. Ein junger Diener, der Jahre später zurückblickt und die Bruchstücke der Geschichte neu zusammensetzt. Der dritte Roman von Verena Roßbacher ist ein literarisches Ereignis - voller psychologischer Brillanz, umwerfender Poesie und doppelbödigem Humor. Es war Christian, der Diener der Zürcher Anwaltsfamilie Hobbs, der den Toten im Gartenpavillon neben der blutbespritzten Chaiselongue fand. Jahre später blickt er zurück und versucht zu verstehen, wie es zu der Katastrophe kommen konnte. Erinnerungen an seine Jugend im österreichischen Feldkirch drängen sich scheinbar zufällig in die Rekonstruktion: Vier genialisch provinzielle Jungs rezitieren am sommerlichen See in sagenhaften Anzügen Zweig und Hesse, haben ihre ganz eigene Theorie zu Frauen mit Locken und das gute Gefühl, dies alles wäre erst der Anfang. Christian erzählt vom Auseinanderdriften der Freunde, von seinen ersten Jahren im Hobbs'schen Haushalt, von verwirrenden nächtlichen Zimmer-besuchen, liebevoll inszenierten Familienporträts und dem fatalen Moment, als die einnehmende Hausherrin seinen alten Freunden begegnet. Und während er die Untiefen der eigenen Schuld auslotet, kommt er einem großen Geheimnis auf die Spur. Ein betörend leichtfüßiger und vertrackt unheimlicher Roman, in dem nichts ist, wie es zunächst scheint.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
- Geräte: eReader
- ohne Kopierschutz
- eBook Hilfe
- Größe: 2.98MB
- FamilySharing(5)
- Text-to-Speech
- Entspricht WCAG Level A Standards
- Entspricht WCAG 2.1 Standards
- Alle Texte können hinsichtlich Größe, Schriftart und Farbe angepasst werden
- ARIA-Rollen für verbesserte strukturelle Navigation
- Text und Medien in logischer Lesereihenfolge angeordnet
- Keine Einschränkung der Vorlesefunktionen, außer bei spezifischen Ausnahmen
- Entspricht EPUB Accessibility Specification 1.1
Verena Roßbacher, geboren 1979 in Bludenz/Vorarlberg, aufgewachsen in Österreich und der Schweiz, studierte einige Semester Philosophie, Germanistik und Theologie in Zürich, dann am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig. »Mon Chéri und unsere demolierten Seelen« ist nach ihrem Debüt »Verlangen nach Drachen« (2009), »Schwätzen und Schlachten« (2014) und »Ich war Diener im Hause Hobbs« (2018) ihr vierter Roman bei Kiepenheuer & Witsch.
Produktdetails
- Verlag: Kiepenheuer & Witsch GmbH
- Seitenzahl: 384
- Erscheinungstermin: 16. August 2018
- Deutsch
- ISBN-13: 9783462318746
- Artikelnr.: 52436449
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
"Guten, puren Stoff" hält Rezensentin Katharina Teutsch mit Verena Roßbachers drittem Roman in den Händen - auch wenn sie beim besten Willen nicht sagen kann, um welches Genre es sich hier handelt. Aber wie die österreichische Autorin, die am Leipziger Literaturinstitut studierte, in ihrer Geschichte um den "modernen" Diener Krischi, der in einer Schweizer Anwaltsfamilie seine erste Stellung annimmt, mit Stilen und Handlungssträngen jongliert, verschlägt der Kritikerin schier den Atem. Sie liest hier von Kunstfälscherskandalen, Culture Clash und Bruderkrieg, staunt, wie geschmeidig Roßbacher zwischen Kunstbetriebssatire, Coming-of-age-Roman und Whodunit switcht. Zwar stellt Teutsch nach der Lektüre dieses hinreißenden "Sprachvaudevilles" fest, dass Roßbacher weniger "anarchistisch" schreibt als früher. Aber wenn sie die "neofeudalen Sprachgesten des Züricher Geldadels" mit der Abgeklärtheit der großen Ironiker verbindet, ist das Leseglück der Rezensentin wiederhergestellt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
» Ich war Diener im Hause Hobbs [...] lässt einen nicht mehr los« Cornelia Wolter Westdeutsche Allgemeine Zeitung 20181206
Gebundenes Buch
Inhalt: Christian Kaufmann schreibt seine Gedanken zu der Zeit, in der er Diener bei den Hobbs in der Schweiz war, nieder. Damals hatte er gerade seine Ausbildung als Diener beendet und wollte in der Welt weit rumkommen. Aus den geplanten 1-2 Jahren, die er höchstens bei den Hobbs bleiben …
Mehr
Inhalt: Christian Kaufmann schreibt seine Gedanken zu der Zeit, in der er Diener bei den Hobbs in der Schweiz war, nieder. Damals hatte er gerade seine Ausbildung als Diener beendet und wollte in der Welt weit rumkommen. Aus den geplanten 1-2 Jahren, die er höchstens bei den Hobbs bleiben wollte, wurden mehr als 10 Jahre. Geendet hat diese Zeit mit einem mysteriösen, hier gleich zu Beginn erwähnten, Todesfall und einen empörenden Skandal. Noch heute rätselt er, wie es dazu kommen konnte. War er blind für die Ereignisse um ihn herum, oder verstand er nur nicht die Menschen, die ihn umgaben? Diese Aufzeichnungen sollen ihm helfen das Unerkannte zu erkennen.
Wertung: Die zu Beginn gestellte Frage, wie es denn zu dem Mordfall kam, findet nicht wirklich ihre Antwort. Das Thema zieht sich versteckt durch das ganze Buch. Andere Dinge werden hier vorrangig abgehandelt. Familienverhältnisse und Talente, bzw. Hobbies werden ausführlich vorgestellt, Ereignisse aus seiner Jugendzeit aufgeführt und der Freundeskreis genauestens erkundet. All das gehört allerdings zu den Eigenarten von Krischi, wie er liebevoll von Freunden genannt wird, als nicht als Kritik zu verwenden. Seine oft langsame und verworrene Denkweise kann der Leser hautnah miterleben und wird nicht abgeneigt sein hin und wieder den Kopf zu schütteln. Dennoch ist es amüsant, wie er sich in seinen Beschreibungen und Erklärungen vergeht. Der Schreibstil ist auch dem eines versnobten Butlers angepasst und unterstreicht die lustige Seite des Buches hiermit.
Zum Ende hin erhöhen sich die Spannung und auch das Tempo. Hier ist der Leser in Erwartung der Aufklärung. Aber viele Abzweige in Nebenhandlungen machen es einem sehr schwer wirklich folgen zu können. Letztendlich bleiben einige Fragen offen und auch nach Beendigung des Buches gibt es noch lange Grund über das Gelesene nachzudenken.
Fazit: Es war schon recht anstrengend, den Aufzeichnungen des Butlers zu folgen. Ein einfaches Weglesen war nicht möglich. Es ist doch eines der anspruchsvolleren Bücher, bei dem man auch nachdenken, hinterfragen und genauer lesen sollte. Ich persönlich werde es mir noch einmal zu Gemüte ziehen, da ich immer noch das Gefühl habe einiges nicht verstanden zu haben. Vielleicht ist es aber auch Absicht, da ja der Butler letztendlich wohl auch die Frage nach dem Warum nicht beantworten kann.
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Retardieren als Stilmittel
Mit ihrem dritten Roman «Ich war Diener im Hause Hobbs» hat die österreichische Schriftstellerin Verena Rossbacher geradezu ein Paradebeispiel für die literarische Methode des unzuverlässigen Erzählens geliefert. Und beginnt damit gleich …
Mehr
Retardieren als Stilmittel
Mit ihrem dritten Roman «Ich war Diener im Hause Hobbs» hat die österreichische Schriftstellerin Verena Rossbacher geradezu ein Paradebeispiel für die literarische Methode des unzuverlässigen Erzählens geliefert. Und beginnt damit gleich im Prolog: «Dies ist eine einfache Geschichte», - was ja auch schon der ins wohlgeordnet Beschauliche weisende Buchtitel suggeriert. Das stimmt sogar bis weit über die Buchmitte hinaus, dann allerdings wird ihre Geschichte von Täuschung und Betrug im letzten Drittel denn doch zunehmend kompliziert. Und lockt bewusst auf falsche Fährten, um dann in einem verwirrenden Sumpf von Andeutungen und Mutmaßungen mit dem Satz zu enden: «Es ist ein wahnsinnig schlampiger Tag». Gleich zu Beginn findet der Diener und Ich-Erzähler im blutbespritzten Pavillon der pompösen Villa seiner Arbeitgeber einen Toten, und auch da schon wird der Leser zunächst im Unklaren gelassen, wer der Tote denn eigentlich ist. Wie konnte es dazu kommen? Er versucht im Nachhinein, die Hintergründe des damaligen Geschehens zu verstehen.
Aus dem Abstand vieler Jahre erzählt Christian von seiner ersten Anstellung als frischgebackener Absolvent einer renommierten Dienerschule bei der neureichen Züricher Familie Hobbs, bei der er mehr als zehn Jahre beschäftigt war. Ausführlich berichtet er als stiller, zur Diskretion verpflichteter Beobachter vom mondänen Leben in der Villa am Zürichsee, von der Familie des vielbeschäftigten Staranwalts Hobbs und seiner ebenso attraktiven wie charmanten, kunstinteressierten Frau, den beiden netten kleinen Kindern und dem Zwillingsbruder des Hausherrn, der im Gartenpavillon wohnt, in dem sich auch sein Maleratelier befindet. Christian hält unbeirrt an den altehrwürdigen Ritualen der snobistischen Butler-Zunft fest, deren verstaubtes Image geradezu ideal zum servilen Selbstverständnis des jungen Mannes passt. In ausgedehnten Rückblicken erzählt er zudem von seiner Jugendzeit als Hipster und eher passiver Teil eines vierblättrigen Kleeblatts von aufmüpfigen Schulfreunden, die auch Jahre später noch sehr eng befreundet sind. Als seine Freunde mit der weltoffenen Frau Hobbs anlässlich eines Besuchs in Feldkirch, dem Vorarlberger Geburtsort von Christian, zusammentreffen, entwickelt sich zu seinem Entsetzen eine kumpelhafte Beziehung zu der unkomplizierten Dame des Hauses, die ihm als distinguierter Butler äußerst peinlich ist. Von ihm ungewollt entwickelt sich eine Eigendynamik, mit der das Schicksal seinen Lauf nimmt.
In seiner geradezu zwanghaft betriebenen Rekonstruktion deckt der traurige Held schichtweise nicht nur diverse verborgene Geheimnisse auf und schaut in menschliche Abgründe, er betreibt damit en passant auch eine Suche nach der eigenen Realität. In großen Bögen erzählt Verena Rossbacher von dieser Selbstverwirklichung, von Schein und Sein, von Lüge und Betrug. Sie tut dies ironisch und demaskiert dabei genüsslich den Kunstbetrieb ebenso wie die heutige Wohlstandsgesellschaft. Die allesamt sympathischen Figuren ihrer rätselhaften Geschichte sind stimmig beschrieben, ihre Diktion erinnert allerdings an die verstaubte Vorlage eines Arthur Conan Doyle und wirkt dadurch, trotz der oft eher surrealen Wendungen in ihrem verzwickten Plot, ziemlich artifiziell.
Die im Prolog listig geweckte Neugier wird leider durch lange Exkursionen des gedanklich trägen, schwerfälligen Protagonisten auf eine harte Probe gestellt: «Aber ich schweife ab» heißt es öfter, - und oft vergisst er dabei sogar die Frage, die er selbst aufgeworfen hat. Störend ist vor allem, dass vieles allzu lange offen bleibt und man sich als Leser dann in einem Wirrwarr verschiedenster Erzählfäden irgendwie zurechtfinden muss. Dieses künstliche Retardieren mit allen Mitteln, mit erzählerischen Umwegen und gedanklichen Sackgassen, mit immer neuen Wendungen stört den Lesegenuss erheblich, zumal es letztendlich zu nichts hinführt, sondern in einer enttäuschenden Leere endet. Nichts stimmt da mehr!
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Nach „Verlangen nach Drachen“ und „Schwätzen und Schlachten“ ist „Ich war Diener im Hause Hobbs“ das neueste Werk von Autorin Verena Rossbacher. Geheimnisse kochen hoch, die ein Kartenhaus zusammenbrechen lassen.
Nach seiner Ausbildung zum Butler …
Mehr
Nach „Verlangen nach Drachen“ und „Schwätzen und Schlachten“ ist „Ich war Diener im Hause Hobbs“ das neueste Werk von Autorin Verena Rossbacher. Geheimnisse kochen hoch, die ein Kartenhaus zusammenbrechen lassen.
Nach seiner Ausbildung zum Butler erhält Christian Kauffmann eine Anstellung im Haus der Familie Hobbs. Die Stimmung im Züricher Anwesen wird von den Zwillingen Anwalt Jean-Pierre und Künstler Gerome bestimmt. Gegensätzlicher könnten Brüder kaum sein. Christian stößt bald auf so manches Geheimnis.
Der Prolog greift vor und weckt die Neugierde auf schlimme Ereignisse. Die Geschichte wird in der Ich-Perspektive aus Sicht von Christian, genannt Krischi erzählt. In seinen Erinnerungen und Gedanken driftet er oft ab. Rückblicke z.B. in die Schulzeit, lassen die Freundschaft von Krischi, Olli, Gösch und Isi aufleben. Besonders Gösch und Olli sind interessante Charaktere. Eine Matheklausur wird zum humorigen Debakel. Solche kleinen Anekdoten sorgen für Unterhaltung. Krischi bedient sich seit seiner Ausbildung einer distinguierten Sprache. Anfangs entsteht der Gedanke, die Hauptfigur wäre wesentlich älter. Umso überraschender die Auflösung. Auch ist nicht ganz klar, in welcher Zeit die Geschichte spielt. Im Hause Hobbs wird Christian „Robert“ genannt. Der Job hat seine Herausforderungen. Als Butler kriegt Krischi mehr mit, als ihm lieb ist. Je länger er bei den Hobbs arbeitet, desto mehr Geheimnisse muss er bewahren. Die Tücken und Fettnäpfchen eines Butlerlebens stehen im Zentrum des Romans. Die Geschichte wirkt sehr realistisch. Das Rätsel um die schicksalhafte Eskalation setzt Spekulationen in Gang. Wer ist das Opfer? Nur langsam fügt sich aus den Puzzlestücken ein Bild zusammen. Wer trägt Schuld? Die Krimielemente sorgen für Spannung. Abschweifungen vom Anfang rücken an die richtige Stelle. Eine Reise bringt neuen Schwung in die Geschichte. Nichts läuft nach Plan. Es entwickelt sich eine amüsante Eigendynamik. Zum Schluss nimmt der Ernst zu. Eine Zuspitzung und Wendung ist gelungen. Dann zeigt der Plot unnötige Schwächen. Irreführungen werden überstrapaziert. Die dramatischen Geschehnisse bleiben, trotz aller Erklärungen, nicht nachvollziehbar. Vieles wirkt zu konstruiert. Es fällt leicht, das Unbegreifen der Entwicklungen mit Krischi zu teilen. Warum? Die Frage taucht zum Ende mehrfach auf und findet keine zufriedenstellenden Antworten. Ein Brief wird gar nicht erst wiedergegeben. Schade, hier wurden entscheidende Dinge versäumt und die Überraschungen gehen nicht mehr auf.
Der Titel hätte kreativer in Szene gesetzt werden können. Das Weiß für den Hintergrund ist zu schlicht. Die Details dagegen passen gut. „Ich war Diener im Haus Hobbs“ bietet besonders in humorigen Szenen gute Unterhaltung. Gerne hätte es noch mehr davon geben können. Das Rätselhafte ist bis zur endgültigen Auflösung sehr gut gelungen. Zu viel Schwere, Drama und Trauer zum Schluss will nicht so recht zum Rest passen. Raffinesse hätte auch auf andere, Weise aufgehen können. Der Epilog rettet nichts. Die Sympathie für Krischi und seine Freunde bleibt. Ein anderes, herzerwärmenderes Ende wäre wünschenswert gewesen.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Very british unterwegs in der Schweiz: Das betrifft sowohl den Roman in seiner Gänze als auch dessen Protagonisten, nämlich Christian Kauffmann aus Feldkirch in der Schweiz, einem Ort, der sich solch prägnanter Ereignisse wie der Durchreise von James Joyce rühmt. Krischi, wie er …
Mehr
Very british unterwegs in der Schweiz: Das betrifft sowohl den Roman in seiner Gänze als auch dessen Protagonisten, nämlich Christian Kauffmann aus Feldkirch in der Schweiz, einem Ort, der sich solch prägnanter Ereignisse wie der Durchreise von James Joyce rühmt. Krischi, wie er von (Jugend)Freunden - das sind Olli, Isi und Göschi, die in der Handlung von durchaus relevanter Bedeutung sind und zwar durchgehend - und Familie genannt wird, entscheidet sich für einen eher ungewöhnlichen beruflichen Weg: er wird Butler und lernt diesen Beruf von der Pieke auf.
Auch wenn es für Butler eher üblich ist, in einem hochbesternten Großstadthotel anzuheuern, entscheidet sich Krischi dafür, zunächst in einem Züricher Privathaushalt anzuheuern, nämlich bei Familie Hobbs und wird dort zu Butler Robert. Er geht ganz darin auf, und bleibt dort über ein Jahrzehnt, viel länger als gedacht und hat sich eine ganz bestimmte Position, ein ganz spezielles Verhältnis zur Familie erworben. Auch mit seinen Freunden und mit Feldkirch insgesamt hält er den Kontakt und pflegt zudem eine Beziehung zum Amerikaner John.
Doch ganz gegen seinen Willen fließen seine beiden Welten - das Privatleben und die Berufswelt aufs fatalste Zusammen und er kann nichts tun, um dieses zu verhindern.
Ein komplexes und sehr besonderes Buch ist es, das die Schweizerin Verena Rossbacher geschrieben hat: ihr dritter Roman. Man könnte auch sagen, er sei kompliziert im Sinne von umständlich, denn im ersten Teil wird sehr detailliert eine Handlungsbasis, eine Art Bühne geschaffen, bevölkert mit Figuren und Handlungsorten. Doch wenn man sich geduldig auf den Stil einlässt, stellt sich all das als sehr passend heraus, genau überlegt und in die Wege geleitet für ein fulminantes Finale.
Zudem ein - zumindest aus meiner Sicht - ein sehr britisches Vorgehen, das die satirischen Elemente dieses Romans - die durchaus zahlreich vorhanden sind, bestens zur Geltung bringt. Darüber hinaus spielt Verena Rossbacher mit der Wahrheit - der realen und der Wahrheit(en) des Romans, dass es eine Freude ist.
Wer Lust hat auf ein ungewöhnliches Leseerlebnis, das leichtfüßig daher kommt, dennoch höchste Konzentration bei der Lektüre erfordert - um wirklich jedes Detail mitzubekommen und es überhaupt zu verstehen, sollte man imstande sein, den Text in seiner Gänze zu würdigen und damit meine ich: Wort für Wort, der sei herzlich ermuntert, zu diesem Buch zu greifen. Er wird es nicht bereuen!
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Vorweg: Auch wenn in den ersten zwei Zeilen dieses Buches steht: 'Dies ist eine einfache Geschichte.' - das ist es ganz sicherlich nicht. Vielleicht noch die Grundform: Ein nicht mehr ganz junger, aber auch nicht zu alter Mann erzählt, wie er zu dem wurde, der er jetzt ist. Der sich schuldig …
Mehr
Vorweg: Auch wenn in den ersten zwei Zeilen dieses Buches steht: 'Dies ist eine einfache Geschichte.' - das ist es ganz sicherlich nicht. Vielleicht noch die Grundform: Ein nicht mehr ganz junger, aber auch nicht zu alter Mann erzählt, wie er zu dem wurde, der er jetzt ist. Der sich schuldig fühlt und mit diesem Bericht den Versuch unternimmt, seine Frage nach der Schuld zu klären.
Christian, der Protagonist, tritt seine erste Stelle als Butler bei einer Familie in Zürich an, die sich mit ihm und er sich mit ihr sehr wohl fühlt. Dies ändert sich, als seine Arbeitgeberin Freunde von Christian kennenlernt und sich sein Privatleben wie auch sein Beruf zu überschneiden beginnen. Ein Drama nimmt seinen Lauf.
Die Geschichte an sich ist gut bis zur Hälfte vergleichsweise unspektakulär; es ist die Beschreibung von Christians Leben mit der Familie Hobbs sowie die Zeit davor in seinem Heimatort Feldkirch mit den engsten drei Freunden Olli, Isi und Gösch. Es ist der Schreibstil der Autorin, der diesen bis dahin eher harmlosen Bericht zu etwas Besonderem macht. Verena Rossbacher lässt ihren Protagonisten in einer unglaublich exakten wie auch bildhaften Sprache alltägliche Szenen erzählen, die dadurch zu etwas Außergewöhnlichem werden: "Herr Hobbs hatte sein Jackett abgelegt, weich und wie eine fläzende, grau gemusterte Katze lungerte es auf dem großen Sessel im Erker, ..., und die Schuhe, scheinbar nachlässig von den Füssen gestreift, lagen tändelnd neben Frau Hobbs' glitzernden, eleganten Stilettos ..." Daneben gibt es wunderbare Exkurse der unterschiedlichsten Art, wie beispielsweise zu Schuld oder zu Pflichten an sich im Alltag (grandios!). Die Szenarien wechseln rasch zwischen Gegenwart und Vergangenheit und man muss mit Konzentration bei der Lektüre bleiben, um nicht den roten Faden zu verlieren.
Ab der zweiten Hälfte folgt jedoch eine Überraschung der nächsten, nichts ist mehr zu spüren von der Gleichförmigkeit, die bis dahin den Text bestimmte. Glaubt man als Lesende mehr oder weniger zu wissen, was geschah, wird allerdings die Verblüffung von Seite zu Seite zu größer. Und erst jetzt stellt man fest, wie raffiniert diese mehr als 370 Seiten miteinander verbunden sind. Denn bereits zu Beginn gibt es die ersten Andeutungen auf das, was sich erst am Ende herausstellt. Es lohnt sich, nach Beendigung der Lektüre noch einmal nach vorne zu blättern, um einzelne Passagen nochmals zu lesen.
Eine grandiose, anspruchsvolle Unterhaltung, hinter der mehr steckt als man auf den ersten Blick erkennt.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für