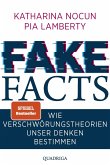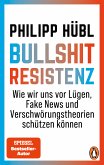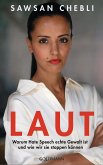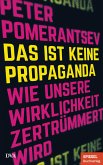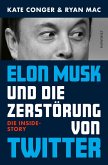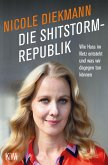Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, SLO, SK ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Der Gründer des Facebook-Projekts #ichbinhier berichtet von seinen Erfahrungen
Eine dieser Diskussionen im Netz: Die Stimmung ist aufgeladen, der Ton feindselig, ein Nutzer formuliert eine Drohung. Wie das gemeint sei, schreibt der andere. Es gehe doch darum, sich miteinander auszutauschen. Nur wenige Sekunden verstreichen, und schon steht der Satz in der Kommentarspalte: "Ich würde Selbstjustiz üben, sofern mir die Zeit bliebe."
Begegnungen wie diese hat Hannes Ley bei seinem Kampf gegen die Verfügungsgewalt der Trolle im Internet zusammengetragen und den Kapiteln seines Buches vorangestellt. Sie zu lesen erzeugt Gänsehaut, aber Ley, der in Hamburg als Kommunikationsberater arbeitet, entscheidet sich dann gegen den effektvollen Grusel. Eindringlich und klar beschreibt er, wie sein Facebook-Projekt #ichbinhier seit mehr als einem Jahr gegen Lügen und Hass im Internet vorgeht. Das Vorbild für die Gruppe, deren Mitglieder menschenfeindliche Kommentare und Falschaussagen auf Facebook entkräften, entlarven oder melden, stammt aus Schweden und heißt #jagärhär.
"#ichbinhier" liest sich wie eine Anleitung zum Umgang mit zerstörerischen Dynamiken im Netz. Der Autor beginnt bei den Ursprüngen des Hasses im Internet, beim Glauben an einen rechtsfreien Raum, widmet sich der Entstehung von Filterblasen, dem Phänomen der sich viral verbreitenden Memes und dem Übergang von phantasievollen Spekulationen über eine Wiedergeburt Elvis Presleys zu gefährlich präsenten Theorien über eine Weltverschwörung.
Einiges davon ist bekannt. Im Kontext der Erfahrungen der aufklärenden Facebook-Gruppe gewinnen die Betrachtungen jedoch an Brisanz. Da sind die Begegnungen mit sogenannten Infokriegern, mit russischen Trollen, die in Tausende Kilometer entfernten Bürogebäuden die Kommentarspalten westlicher Medien füllen, oder mit Leuten wie dem wegen Volksverhetzung verurteilten Schriftsteller Akif Pirinçci.
Schuld gibt der Autor auch einzelnen Medien, die mit kontroversen Themen einen Dauerzustand der Empörung erzeugen und die Reaktionen nicht moderieren. Vor allem aber kritisiert er die Plattform Facebook selbst, die unentwegt gegen eigene Gemeinschaftsstandards verstoße. Damit ist seine Zustandsbeschreibung mitten im Wirbel um die unerlaubte Nutzung der Daten von fünfzig Millionen Facebook-Nutzern für den Wahlkampf Donald Trumps gerade wieder tagesaktuell geworden. Einige Monate nach dem Start des Projekts lud Facebook Ley und seine Mitstreiter zum Training für "Counterspeech", den Umgang mit Hasskommentaren. Etwas Neues habe er nicht gelernt, auch keine Antwort darauf erhalten, warum nur so wenige Beiträge gelöscht würden und was konkret geplant sei, um Hass und Lügen zu reduzieren.
Das Projekt, das 2017 den Grimme Online Award gewann, hat inzwischen 37 000 Abonnenten. Im Netz brandet immer wieder Kritik auf. Die Online-Aktivisten seien Ideologen, Blockwarte des Internets. Tatsächlich versuchen sie sich an einer Aufgabe, die eigentlich bei den großen Netzkonzernen und der Politik läge.
ELENA WITZECK.
Hannes Ley: "#ichbinhier". Zusammen gegen Fake News und Hass im Netz.
DuMont Buchverlag, Köln 2018. 206 S., geb., 20,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main