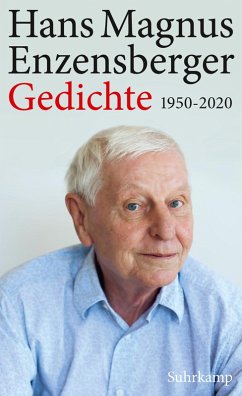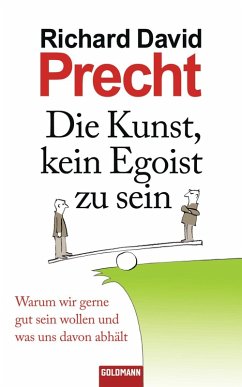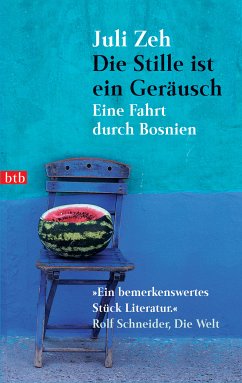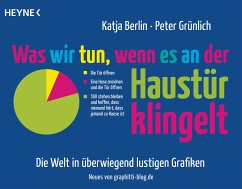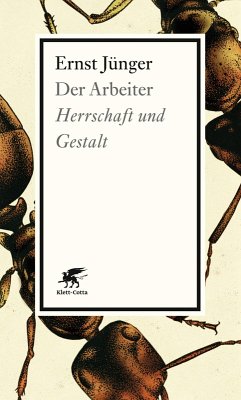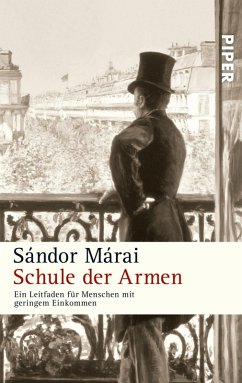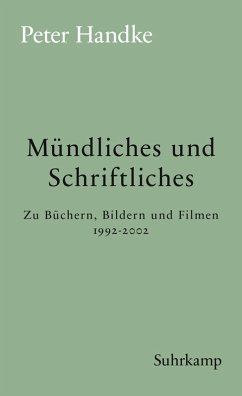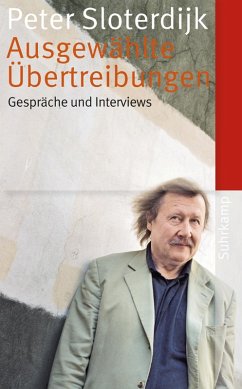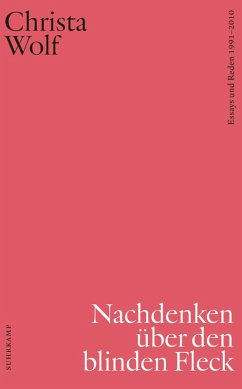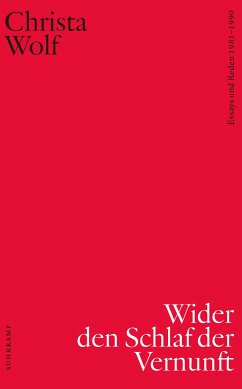Im Irrgarten der Intelligenz (eBook, ePUB)
Ein Idiotenführer
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 15,00 €**
14,99 €
inkl. MwSt.
** Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Intuitiv heftet man Freunden oder Kollegen schnell den semantischen Orden »hochintelligent« ans Revers, Intelligenz gilt neben Flexibilität und Teamfähigkeit als Kardinaltugend der Gegenwart. Wenn der subjektiv plausible Befund jedoch objektiviert werden soll, stößt man auf seltsame geometrische Figuren, Zahlenreihen und Listen mit Tieren, von denen eines angeblich nicht zu den anderen paßt. In seinem Essay setzt sich Hans Magnus Enzensberger mit der Geschichte und den Tücken der Verfahren auseinander, mit denen Psychologen seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts an der Vermessung der Int...
Intuitiv heftet man Freunden oder Kollegen schnell den semantischen Orden »hochintelligent« ans Revers, Intelligenz gilt neben Flexibilität und Teamfähigkeit als Kardinaltugend der Gegenwart. Wenn der subjektiv plausible Befund jedoch objektiviert werden soll, stößt man auf seltsame geometrische Figuren, Zahlenreihen und Listen mit Tieren, von denen eines angeblich nicht zu den anderen paßt. In seinem Essay setzt sich Hans Magnus Enzensberger mit der Geschichte und den Tücken der Verfahren auseinander, mit denen Psychologen seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts an der Vermessung der Intelligenz arbeiten. Er kommt zu dem Ergebnis: »Wir sind eben nicht intelligent genug, um zu wissen, was intelligent ist.«
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, I ausgeliefert werden.