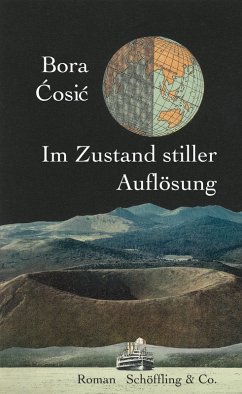Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Ein düsterer und doch bisweilen komischer Reflexionsroman: Bora Cosic befindet sich in "stiller Auflösung".
Im Jahr 1972 geriet Bora Cosic wie viele andere Künstler und Intellektuelle in den Strudel einer veränderten jugoslawischen Kulturpolitik. Im Nachwort zur grandiosen deutschen Übersetzung seines Opus magnum "Die Tutoren" hat er beschrieben, wie das vor sich ging. Seine Bücher wurden nicht verboten, sie verschwanden einfach aus den Buchläden. Er wurde nicht verhört oder verhaftet - "unser Kommunismus war schließlich ,rosarot'" -, man bedeutete ihm lediglich, er solle sich erst einmal still verhalten.
Knapp zwanzig Jahre später verschwand ein anderes Buch, das gerade erst veröffentlicht worden war, jedoch unglücklicherweise in Sarajevo, wo es in den jugoslawischen Erbfolgekriegen unterging. Ob es eventuell auch zu jenen gehörte, die damals in der Stadt massenhaft von serbischen Soldaten vernichtet wurden, weil sie in lateinischer statt kyrillischer Schrift publiziert waren, ist nicht mehr festzustellen. "Für mich war das Buch tot und neu zu schreiben", heißt es jedenfalls in der Nachbemerkung des Autors, und zwar, wie er ausdrücklich betont, "angesichts der Masse neuer Beweise, wie tief der Mensch sinken kann, vor allem, wenn der Verstand aussetzt". Dieses zu neuem Leben erweckte Buch liegt nun in der deutschen Übersetzung von Brigitte Döbert vor, die bekanntlich für ihre Übertragung der "Tutoren" vor zwei Jahren den renommierten Straelener Übersetzerpreis erhalten hat und diesen Autor bestens kennt.
Der Erzähler, dem man guten Gewissens große Gemeinsamkeiten mit dem Autor unterstellen kann, zumal er dessen Beruf teilt, möchte eigentlich auf den Spuren Marcel Prousts in die Normandie, nach Cabourg. Wir sind erkennbar am Anfang der neunziger Jahre, das digitale Zeitalter hat noch nicht begonnen. Das französische Ehepaar, das ihn und seine Frau begleitet, überredet ihn aber, stattdessen nach Tréboul in der Bretagne mitzukommen, wo Proust nie gewesen ist. Man quartiert sich dort in einem Hotel ein, dessen Inhaber Armand mit seinen Gästen gern über Gott und die Welt, vor allem aber über "uns" und "die anderen" räsoniert.
Der Erzähler zeichnet sich nun vor allem dadurch aus, dass er "was" hat. Über dieses "was" wird viel gerätselt und diskutiert, von den Pariser Freunden ebenso wie von seiner Frau, die täglich mit dem Neurologen in Zagreb telefoniert, bei dem ihr Mann in Behandlung ist. Cosic hat dem Roman ein Motto von Italo Svevo vorangestellt: "Der beste Beweis dafür, dass ich diese Krankheit nie gehabt habe, ist doch, dass ich nicht geheilt bin."
Die "Krankheit", das "was", das der Erzähler "hat", lässt sich dennoch wenigstens umschreiben. Dass er ein Melancholiker ist, sagt er selbst. "Wollte mir wer diese meine Melancholie austreiben, und sei es ein sogenannter ,bester Freund', es käme einer Katastrophe gleich. Warum kann ich mich nirgends, in keine gesellige Runde einfügen, sondern sehe zu, dass ich schnellstmöglich und oft grußlos Land gewinne?" Seine Melancholie hat also eine stark soziophobe Note. Es ist überhaupt ein Kreuz mit den Freunden. Erst locken sie ihn an einen Ort, in dem Proust nie gewesen ist, und dann hoffen sie, "dass ,das', von dem mein Neurologe nicht sagen kann, was es ist, sich nicht endlos hinzieht, denn würde die komische Krankheit, die komischste, von der ,sie' (die paar) je gehört hätten, ,ewig' dauern, täte ihnen das furchtbar leid und würde sie sehr betrüben. Ich wiederum kann ihnen nicht sagen, ich hätte eigentlich ,nichts' und nur dann ,etwas', wenn mehr Leute um mich herum sind, als ich gewohnt bin, und dass sich das ,Etwas' mit der Personenzahl steigert, die sich nach dem ,Etwas' erkundigen, das ich habe." Kurz gesagt: Lasst mich in Ruhe, dann geht es mir besser, lautet seine Botschaft an seine Mitmenschen.
Und in der Tat fahren die französischen Freunde irgendwann nach Paris zurück, und seine Frau verschwindet zu einem Vortrag, den sie halten muss. Dadurch wird es aber nicht besser, sondern nimmt erst richtig Fahrt auf. Die Melancholie des Erzählers ist nicht weich und klebrig, sie richtet sich nicht vor allem gegen ihn selbst, sondern steigert sich im Lauf der 120 Seiten immer mehr zu einem misanthropischen Weltekel, der zugleich grimmige und hochkomische Züge hat. Der Grimm gilt zunächst der eigenen Arbeit und der der Kollegen. Der Erzähler ahnt, dass sein Buch über Proust nie entstehen wird, und kapituliert, wenn er selbst bei seinen Lieblingsautoren "ein Zeug wie ,sagte er und schloss die Tür hinter sich' lesen muss". Wer schreibt, müsse das Idiotische des Schreibens vor Augen haben, und es gelte, "ein Buch zu schreiben über die Tatsache und die Gründe, warum das Schreiben von Büchern keinen Wert hat." Neun Seiten später bescheinigt er den Geschichten über seine "Abartigkeit", sie seien gar nicht einmal falsch, aber "keine persönliche Eigenschaft von mir: Der Mensch an sich, der ist die Abartigkeit in Person."
Einmal wird kurz eine Glücksvorstellung beschworen und gleich wieder in Frage gestellt: "Ein liegender Mann frei von Gedanken muss der glücklichste Mann Mensch auf Erden sein", reflektiert er im Liegestuhl, "liegen kann nur, wer nichts denkt, kaum fängt das Denken an, ist man nicht mehr in der Lage zu ,liegen'. . ." Wenn Cosic im Roman selbst auch bewusst die Assoziation zu Oblomow weckt, wird bei dieser Glücksvorstellung beim Leser doch auch der Gedanke an den Passus "Sur l'eau" in den "Minima Moralia" wach: "Rien faire comme une bête, auf dem Wasser liegen und friedlich in den Himmel schauen . . ." Das ist ihm jedoch nicht vergönnt, auch nicht "am äußersten Rand des Kontinents . . ., an einem Punkt, der zu Recht Finistère heißt. Ich habe mich aus dem Staub gemacht, mein entsetzliches Land verlassen, das sich über seine amtlich beglaubigte Blödigkeit hinaus als extrem gewalttätig erwies, obwohl ich das für unmöglich hielt."
Die Geschichte holt also den Protagonisten ein. Es sind ja gerade sogenannte große Zeiten, in denen paradoxerweise alles auf Anfang zu stehen scheint und zugleich die Geschichte angeblich an ihr glückliches Ende kommt, eine Illusion, die der Erzähler nicht eine Sekunde lang teilt: schwer möglich mit Blick auf die grauenvollen Ereignisse in seinem zerfallenden Land, die gerade erst begonnen haben.
Und dann richtet sich der Furor vollends gegen die Dummheit des Menschengeschlechts, gegen den nie enden wollenden Drang zur Aktivität, gegen "bescheuerte Kartenspiele, Lotterien und Schachspiele", gegen Marathonläufe und die Verrenkungen am Billardtisch, gegen "die ganzen Verkleidungen, passend zur Aktivität: Radfahrer, Bergsteiger, Taucher, Feuerwehrmann, Philharmoniker! Der Mensch nimmt im Lauf seines Lebens unzählige saublöde Haltungen ein, und selbst, wenn er anständig steht, sitzt oder liegt, macht er unzählige saublöde Gesten, lässt dauernd was fallen, hackt sich ins Bein oder stößt sich den Kopf."
Eine Fehlkonstruktion also, der Homo sapiens. Äußerlich geschieht wenig in diesem Roman: Man reist an, die Frau und das befreundete Ehepaar reisen wieder ab, drei Schweden ertrinken im Meer. Das Buch über Proust wird natürlich nicht geschrieben. Cosics neu geschriebenes Buch dagegen gehört in die Tradition einer düsteren, komischen und dabei zugleich aufklärerischen Literatur: eine Philippika, dabei höchst unterhaltsam. Im "Zustand stiller Auflösung" und der Reflexion darüber verschwimmen natürlich auch die Gattungsgrenzen: Der Roman als Essay, der Essay als Roman. In einer Zeit, wo man sich wieder dumpf auf die eigene "Identität" zurückzieht, haben solche Bücher es natürlich schwer. Umso notwendiger sind sie.
JOCHEN SCHIMMANG
Bora Cosic: "Im Zustand stiller Auflösung". Roman.
Aus dem Serbischen von Brigitte Döbert. Schöffling & Co., Frankfurt am Main 2018. 126 S., geb., 18,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main