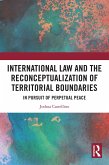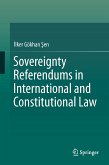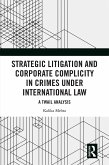Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Der Sog des Imperialen: Antony Anghie sondiert mit heißem Herzen die kolonialen Unterströmungen des modernen Völkerrechts
Die Spuren des Imperialen lassen sich nicht einfach per Generalversammlungsbeschluß aus dem Völkerrecht bürsten. Die historische Begegnung zwischen Kolonialherren und Kolonisierten, die dunkle Spur der "civilising mission", präge bis heute die Disziplin und ihre grundlegenden Konzepte, argumentiert der australische Völkerrechtler Antony Anghie in seiner Studie über die vielschichtigen Bezüge zwischen Imperialismus, Souveränität und der Entstehung des Völkerrechts. Anghie, Professor an der S. J. Quinney School of Law der Universität von Utah, entwirft eine alternative Geschichte der Souveränität, die entlang einer "Dynamik der Differenz" zwischen Europäern und Nichteuropäern, "Zivilisierten" und "Nichtzivilisierten" vermeintlich unverrückbare Grundannahmen in Bewegung bringt. Unser scheinbar so ganz westfälisches Souveränitätskonzept hat, erfahren wir da, seine wesentlichen Konturen nicht in Münster und Osnabrück erhalten, sondern im Kongo, auf Nauru und im Genfer Palais des Nations. In den Tiefenschichten der Souveränität ist die Kolonialgeschichte noch immer gegenwärtig. Und mit ihr der Imperialismus, der sich im "colonial encounter" manifestierte.
Bewußt gebraucht Anghie für die seit dem sechzehnten Jahrhundert von europäischen Mächten kolonisierten Territorien den ambivalenten Begriff einer "Dritten Welt". Als ihr Anwalt distanziert er sich zugleich von der ersten Generation "nachkolonialer" Völkerrechtler, die seit den sechziger Jahren die allgemeinen Grundsätze des europäisch geprägten Völkerrechts auch in den traditionellen Rechtsordnungen ihrer Herkunftsländer zu finden suchten - eine Methode, die zuweilen an die gegenwärtige Suche nach einer "demokratischen Tradition" im islamischen Denken erinnert.
Doch wie sollte man die klassischen Paradigmen des internationalen Rechts auch so einfach aus der Tradition ausgraben können, hier oder dort? Entstanden seien sie schließlich durch Improvisation, an den Bruchstellen des von den Eroberern aufgezwungenen kulturellen Zusammenpralls, die Antony Anghie beschreibt. Im 19. Jahrhundert eröffneten die Kolonien dem von positivistischer Kritik gebeutelten Völkerrecht damit "die gleiche Chance, die sie auch Habenichtsen und verarmten Aristokraten aus den Zentren des Empires boten: etwas aus sich zu machen, sich zu beweisen und zu rehabilitieren".
Angesichts eines "ganz anderen", das man jenseits der eigenen Grenzen vorfand, konturierte sich ein Souveränitätsbegriff nach europäischen Vorstellungen - von Gesellschaft, Rechtsordnung und Politik, Fortschritt und Entwicklung. Wer dem nicht entsprach, blieb außen vor im Nebeneinander gleichberechtigter Staaten, sein Lebensraum war als Terra nullius zur Annexion freigegeben, bestenfalls konnte er auf die protektionistische Heranführung an die europäische Zivilisation hoffen.
Es beginnt, folgt man den Argumentationslinien Antony Anghies, bereits in der Naturrechtslehre der spanischen Spätscholastik, mit dem in Salamanca lehrenden Theologen und Juristen Francisco de Vitoria, der grundlegte, was später durch Hugo Grotius eine Systematisierung erfahren sollte. In seinen Vorlesungen "De Indis Noviter Inventis" und "De Iure Bellis Hispanorum in Barbaros" setzte de Vitoria an die Stelle der universalen Jurisdiktion des Papstes die Ordnung des Ius Gentium, des universellen Naturrechts, dessen Befolgung die Vernunft gebietet. Die universale Norm allerdings ergibt sich für de Vitoria aus der Praxis der Spanier: Ihre Identität wird externalisiert als Basis der Normen des Ius Gentium und zugleich internalisiert als wahrhaft authentische Identität der Eingeborenen, die diese - wie Kinder - nur noch nicht zur vollen Entfaltung gebracht haben. Die christlichen Normen, von de Vitoria als abendländisches Sondergut eingegrenzt, kommen als universales Naturrecht ins Spiel der kolonialen Begegnung zurück. Nicht, weil er göttliches Recht verletzt, ist der Widerstand der Indios gegen die Taufe ein Kriegsgrund für die Konquistadoren, sondern als Affront gegen das vom spanischen Souverän verwaltete universelle Naturrecht. Der Widerstand gegen einen Kolonialismus, der sich hinter dem Universalen versteckt, wird zur Rechtfertigung imperialer Gewalt.
Dieses Muster der Vereinnahmung deckt Anghie immer wieder auf in der transnationalen Geschichte der vergangenen fünfhundert Jahre, von der Berliner Konferenz bis Bretton Woods, von Genf bis Bagdad. Und es durchzieht nicht nur die Ereignisgeschichte, sondern auch die Theorieströmungen des internationalen Rechts: die Naturrechtslehre mit ihrer Universalisierung europäischer Partikularität, den Positivismus mit seinem Modell einer Zweiklassensouveränität von Eroberern und Eroberten und den Pragmatismus der Dekolonisierungsperiode - mit seiner einseitigen Konzentration auf wirtschaftliche Entwicklung, die sich in der Praxis oft als skrupellose Ausbeutung durch die vorgeblichen Schutzmächte verwirklichte.
Zwischen den Zeilen seiner kühlen Analysen schreibt Antony Anghie mit heißem Herzen. Und manchmal mit leidenschaftlichem Zorn, besonders, wo seine historische Untersuchung ins Gegenwärtige einmündet. Der "Krieg gegen den Terror" ist für ihn als Neuaktualisierung imperialistischer Strukturen aber nicht nur ein amerikanischer Sündenfall. Kritisiert wird auch ein liberaler europäischer Imperialismus im Sinne des führenden EU-Diplomaten Robert Cooper, der die postmoderne Staatenwelt der Menschenrechte und des Kosmopolitismus von einer prämodernen scheidet, in welcher man in der Defensive auch nach den Gesetzen des Dschungels agieren darf. Die zuerst von Anne-Marie Slaughter ausbuchstabierte Differenzierung liberaler Demokratien vom Rest der Staatenwelt ist für Anghie nichts anderes als de Vitorias Unterscheidung zwischen Zivilisierten und Unzivilisierten, übersetzt ins Vokabular von Menschenrechten, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit.
Niemand also ist ohne Untiefen, keine Epoche, keine Schule, keine Region. Auch nicht die vormals Unterdrückten, die allzu häufig an ihren eigenen Minderheiten wiederholen, was sie als Gesellschaft von den europäischen Kolonisatoren erfuhren. Vielleicht aber läßt sich aus dem Völkerrecht trotzdem noch etwas Ordentliches machen. Antony Anghie gibt sich bescheiden optimistisch und setzt auf den einzelnen, der mit dem Recht umgeht. Nur das stete Mühen um Selbsterkenntnis könne den Teufelskreis durchbrechen, in dem ein imperiales Völkerrecht als einzige Antwort auf eine hoffnungslos korrupte "Dritte Welt" erscheine, die vermeintlich nur zwei Alternativen habe: entweder das autoritäre Regime eines Saddam Hussein oder shock and awe und die militärische Intervention. Das ist, zugegeben, eine mutige Hoffnung. Doch mit Büchern wie diesem, die dem Völkerrecht auf den Grund gehen, statt seine Grenzen zu überschreiten, kann man sich ihr vorsichtig anvertrauen.
ALEXANDRA KEMMERER
Antony Anghie: "Imperialism, Sovereignty and the Making of International Law". Cambridge Studies in International and Comparative Law, Band 37. Cambridge University Press, Cambridge 2005. XVIII, 356 S., geb., 60,- Pfund.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main