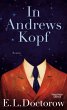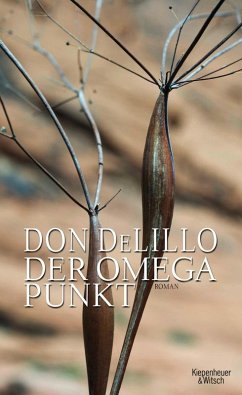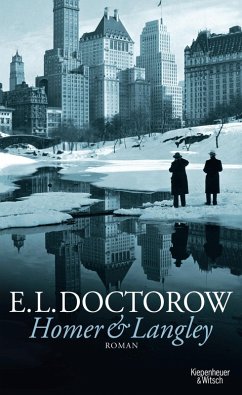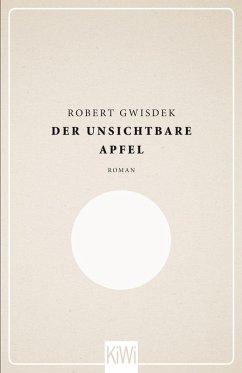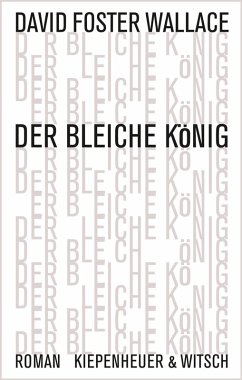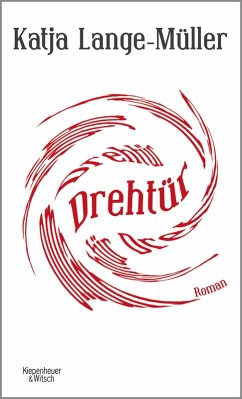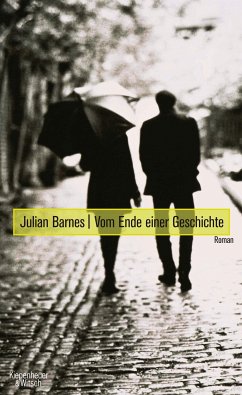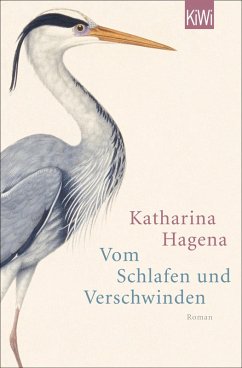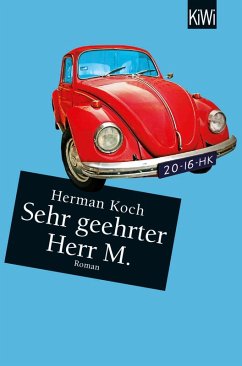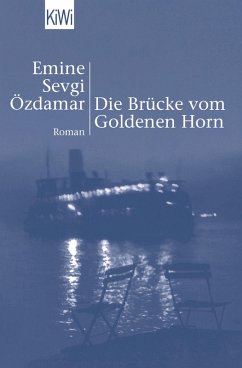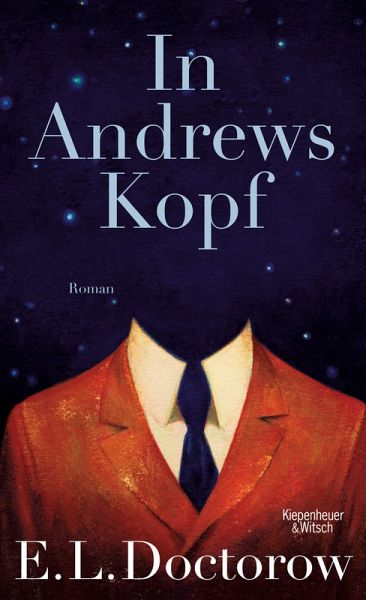
In Andrews Kopf (eBook, ePUB)
Roman
Übersetzer: Krueger, Gertraude
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 18,99 €**
16,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenken

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
»Es gibt keine Fiktion oder Nicht-Fiktion - es gibt nur das Erzählen.« E.L. Doctorow In seinem neuen Roman nimmt uns E.L. Doctorow, einer der ganz Großen der zeitgenössischen amerikanischen Literatur, mit auf eine Reise in das Bewusstsein eines Mannes, dessen Leben nicht immer geradlinig verlief und dem die Trennschärfe zwischen Fakten und Fiktion abhandengekommen zu sein scheint. Andrew erzählt die Geschichte seines Lebens, eines Lebens voller dramatischer Umstände und Tragödien. Er erzählt von seinen Töchtern; die erste starb durch seine Schuld, die zweite musste er weggeben. Er e...
»Es gibt keine Fiktion oder Nicht-Fiktion - es gibt nur das Erzählen.« E.L. Doctorow In seinem neuen Roman nimmt uns E.L. Doctorow, einer der ganz Großen der zeitgenössischen amerikanischen Literatur, mit auf eine Reise in das Bewusstsein eines Mannes, dessen Leben nicht immer geradlinig verlief und dem die Trennschärfe zwischen Fakten und Fiktion abhandengekommen zu sein scheint. Andrew erzählt die Geschichte seines Lebens, eines Lebens voller dramatischer Umstände und Tragödien. Er erzählt von seinen Töchtern; die erste starb durch seine Schuld, die zweite musste er weggeben. Er erzählt von seinen Ehefrauen; von der ersten ist er getrennt, die zweite starb, weil sie am 11. September 2001 joggen ging. Und er erzählt von seinem Traum als Kognitionswissenschaftler: einem Computer, in dem das Bewusstsein sämtlicher Menschen, die je gelebt haben, reproduziert und gespeichert wäre. Und während Andrew erzählt, müssen wir Leser uns fragen, was genau wir denn eigentlich wissen über Wahrheit und Erinnerung, Gehirn und Verstand, über uns und die anderen. Gibt es so etwas wie Schicksal, oder ist am Ende doch alles selbst verschuldet? Andrew jedenfalls ist sich sicher: »Heutzutage kann ich niemandem trauen, am wenigsten mir selbst.« Stilistisch meisterhaft, mit sprachlicher Finesse, aber auch mit viel Humor und psychologischem Gespür lotet E.L. Doctorow die Grenze zwischen Geschichte und Geschichten aus, spiegelt sie an historischen Ereignissen und zeigt uns, welch tiefgehende Wahrheit im Erzählen zu finden ist.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.