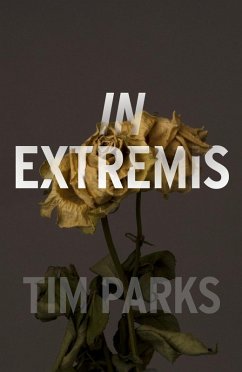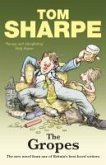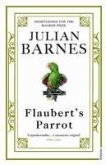But he's set to give a talk to a conference of physiotherapists in the Netherlands; if he leaves now will he get to her deathbed in time?
Will he be able to say what he couldn't say before? He can't concentrate on what is happening now: his mind won't sit still. Should he try to solve his friend's marital crisis? Should he reconsider his separation from his own wife? And why does he need to pee again?
In Extremis is Tim Parks's masterwork: a darkly hilarious and deadly serious novel about infidelity, mortality and the frailties of the human body.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Bonus-Buch für Novizen, Malus-Buch für Kenner: "In Extremis", der neue Roman des Italien-Engländers Tim Parks, erzählt zu viel noch einmal, was der Autor uns schon erzählt hat.
Es sind die geläufigsten Muster von Albträumen: Man will einer Gefahr entrinnen, kommt aber kaum oder gar nicht vom Fleck, man will an einen sicheren Ort gelangen, am liebsten nach Hause, wird aber stets aufs Neue aufgehalten oder irrt verstört durch die Gegend. "In Extremis" - wörtlich: im Sterben (liegend) -, dem neuen, inzwischen neunzehnten Roman des englischen Wahlitalieners Tim Parks, gelingt es nicht nur, diese Nachtmahr-Schemen in eine hellwache Handlung zu überführen, sondern dabei auch noch eine Menge höchst realer Situationen zu schildern, deren schiere Alltäglichkeit vom absurden Aberwitz bald nicht mehr zu unterscheiden ist.
Mutters Zustand verschlechtere sich rapide, er solle am besten sofort nach Hause kommen, wenn er sie noch lebend antreffen wolle: Mit dieser schwesterlichen E-Mail beginnt der Roman. Thomas Sanders, Hauptfigur und Ich-Erzähler, liest sie wenige Minuten, bevor sein Gastvortrag bei der Physiotherapeutentagung im holländischen Amersfoort beginnt. Den Vortrag dennoch halten oder unverzüglich abreisen? Angesichts der auch durch Selbstironie nicht zu bändigenden Eitelkeit des Londoner Wahlspaniers Sanders, der seit Jahrzehnten als Sprachwissenschaftler in Madrid wirkt, entscheidet sich die Frage von allein.
Eitelkeitsverstärkend kommt hinzu: Die Physiotherapeuten haben den Endfünfziger nicht als Fachmann, sondern als Promi-Patienten zu sich geladen. Also beschließt Sanders noch im Hotel, nach seinem - übrigens sehr gut honorierten - Erfahrungsbericht über ein neues Massagegerät werde er nicht einmal die Diskussion abwarten, sondern sofort den Bus vom Tagungszentrum zum Bahnhof, den Zug zum Amsterdamer Flughafen Schiphol, den nächstmöglichen Flieger nach London-Gatwick, die Lokalbahn nach Clapham Junction und von dort ein Taxi ins Krebshospiz von Claygate nehmen, wo die sterbende Mutter, so nimmt er an, seiner wie einer Erlösung harre.
Natürlich kommt alles anders, auch wenn die äußere Abfolge des Geschehens mit Sanders' ursprünglichem Plan immerhin ein paar Ähnlichkeiten aufweist. Genau diese Differenz zwischen Wollen und Wirklichkeit macht den Reiz des Romans aus, sie genauer nachzuerzählen verbietet sich deshalb. Jedenfalls benötigt der Ich-Erzähler 150 Seiten - es sind die besten des Buchs -, ehe er vor dem Sterbezimmer ankommt, um dort von der Pflegerin den Rat zu erhalten, er solle die Mutter besser nicht stören, habe sie doch nach entsetzlichen Komplikationen endlich in einen vormoribunden Erholschlaf gefunden.
Tim Parks, 1954 in Manchester als Sohn eines predigtstarken anglikanischen Pfarrers und dessen nicht minder glaubensenthusiastischer Ehe- und Hausfrau geboren, ist so etwas wie der um eine Generation jüngere Martin Walser der englischen Gegenwartsliteratur. Er hat seit "Tongues of Flame" (deutsch: "Flammenzungen"), dem Erzähldebüt von 1985, Roman für Roman die Welt zu seinem Fall gemacht, also lauter mal mehr, mal weniger autobiographische Bücher publiziert. Im besten Fall haben sie sich jeweils zu Gesellschaftspanoramen der Mittelschicht geweitet.
Dass er zu Hause nicht so bekannt und berühmt wurde wie Walser hierzulande, hängt auch mit der von 1980 an selbst gewählten Situation des "Expat", des ständig im Ausland lebenden Engländers, zusammen. Der britische Literaturbetrieb ist, um das Wenigste zu sagen, in solchen Dingen nachtragend, ja missachtend. Es nimmt deshalb auch nicht wunder, dass der einzige der vielen Romane, der je auf die Shortlist für den Booker Prize gelangte, die Erzählsatire "Europa" (1997) war, die dann Arundhati Roys "Gott der kleinen Dinge" unterlag. Tim Parks übrigens ist - wie in Sachen Eitelkeit nicht ohne Selbstironie - unmittelbar nach dem Brexit-Votum von 2016 Italiener und damit dauerhaft EU-Bürger geworden. Und er hat, ganz unironisch, neben so herrlichen Romanen wie "Weißes Wasser" (2005) und "Stille" (2006) mit der komödiantischen Tagebuchtragödie "Eine Saison mit Verona" (2003) auch eines der allerbesten Epen über den Fußball verfasst.
"In Extremis" ist extrem autobiographisch angesichts der meist subtilen Transformationen dieses Autors, bei denen das eigene Erleben vor allem als Folie für Allgemeingültigeres dient. Nahezu ohne ästhetische Camouflage expliziert, rekapituliert und bilanziert der neue Roman mithin die Geschichte der anglikanischen Pfarrersfamilie Sanders/Parks, die Mitte der Sechziger von Manchester über Blackpool nach London kam und dort sesshaft wurde. Als Familienroman ist "In Extremis" ein Bonus-Buch für Leser, die von Tim Parks und seiner lakonischen, witzig-sarkastischen, dabei unaufdringlich intellektuellen Schreibart bisher wenig wissen.
Für eingeübte Parks-Adepten aber ist es ein Malus-Text. Sie können sich zwar über die komplexen Ambivalenz-Strategien amüsieren, mit denen der ungläubige Thomas Sanders seine Mutterliebe durch permanentes Rebellieren am Ende doch zu bewahren versteht. Alles Übrige jedoch ist wenig mehr als variierende Wiederholung. Im Roman "Thomas & Mary", der erst vor zwei Jahren erschien, hatte Parks das finale Scheitern einer scheinbar ewigen Ehe geschildert und uns auch mit der gut dreißig Jahre jüngeren Neugeliebten des alternden Protagonisten bekannt gemacht. Das erfahren wir jetzt in anderer Kulisse noch einmal. Wozu?
Viel schlimmer, damit richtig quälend, ist jedoch, dass und wie der Autor den in toto klugen und erkenntnisreichen Essay "Die Kunst stillzusitzen" von 2010 nun romanhaft recycelt. "Ein Skeptiker auf der Suche nach Gesundheit und Heilung" lautet der Untertitel des Aufsatzes. Bereits vor acht Jahren hat Parks unsere Geduld mit der nicht endenden Symptomatologie männlicher Unterleibsleiden strapaziert: Harndrang, Prostatavergrößerung, temporäre bis latente Impotenz, uncharmante Darmprobleme, dergleichen mehr. Aber er hat der somatischen wie psychosomatischen Suada eben auch die Hellsicht einer profunden Selbsterweiterung durch meditierendes Ab- und Umschalten abgewonnen.
Dem neuen Roman werden die Blasenschwäche wie die Darmkonvulsionen der Hauptfigur zum bloßen Anlass eines exhibitionistischen Dauererzählens - auf nahezu jeder dritten Seite ist von ihnen die Rede. Das ist nicht mutig, sondern fatal und unter dem Niveau des Autors. Zum Glück erschöpft sich das Buch in solchen Passagen nicht.
JOCHEN HIEBER
Tim Parks: "In Extremis". Roman.
Aus dem Englischen von Ulrike Becker. Verlag Antje Kunstmann, München 2018. 431 S., geb., 24,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main