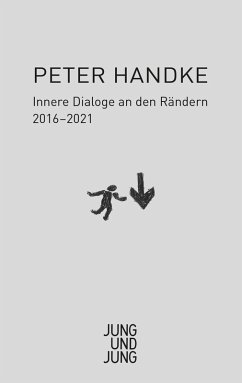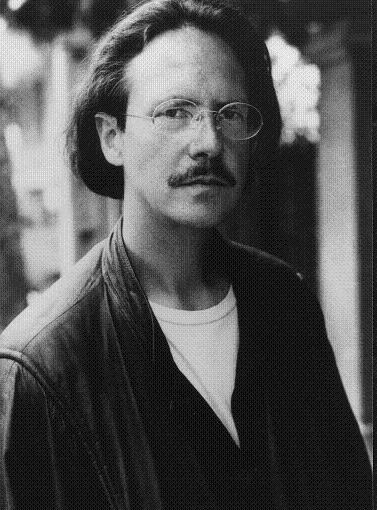(Deutsch)Im vielfältigen Werk Peter Handkes gehören die Journale gewiss zu den Büchern, in denen uns Leserinnen und Lesern der Dichter am nächsten kommt, auch in seinem »Ideal«, in der »Souveränität eines, der von niemandem etwas will, von niemandem etwas fordert, von niemandem etwas erwartet«. Seine über die Jahre gesammelten Aufzeichnungen sind ein Wunder der Literatur. Handke zitiert darin (auswendig) aus seinen Lektüren, aus Tolstoi, Goethe, Doderer, Simenon, aus der Apostelgeschichte u. a., blättert im bereits knisternden Griechisch-Deutsch-Schulwörterbuch, schreibt an der »Obstdiebin «, später an »Zdenek Adamec« und an »Das zweite Schwert«, zweifelt, wundert sich, horcht, beobachtet mit zartem Blick seine nahe Umgebung und erdichtet wieder und wieder ein 11. Gebot. Wir dürfen ihn durch die Jahre bei all dem begleiten, auch durch die »Quarantänestille « der jüngsten Zeit.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.