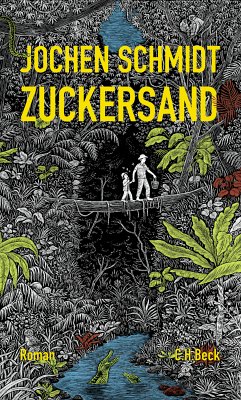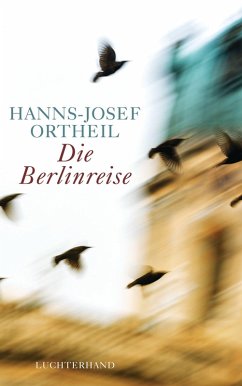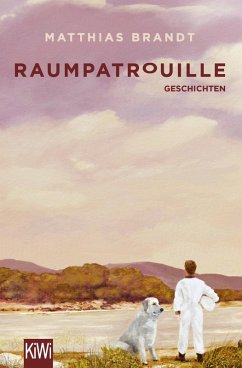Inniger Schiffbruch (eBook, ePUB)
Sofort per Download lieferbar
Statt: 25,00 €**
16,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Die Beschäftigung mit dem Nachlass seines verstorbenen Vaters ruft im Erzähler von Frank Witzels autobiografischem Roman Erinnerungen an eine Kindheit wach, in der das Fernsehen den Vorabend erfindet. Eine Kindheit voller Disziplinierungsmaßnahmen wie Hausarrest, Tonband- und Fernsehverbot, in der die Eltern ihrem Kind unwissentlich den Schrecken der einst selbst erlittenen Trennung als unentwegte Drohung weitergeben. Eine Kindheit, in der ein Sonntag klar strukturiert, die Kittelschürze für die Hausfrau unabdingbar und die von Erwachsenen erdachte Mondfahrt Peterchens ein Horrorszenario ...
Die Beschäftigung mit dem Nachlass seines verstorbenen Vaters ruft im Erzähler von Frank Witzels autobiografischem Roman Erinnerungen an eine Kindheit wach, in der das Fernsehen den Vorabend erfindet. Eine Kindheit voller Disziplinierungsmaßnahmen wie Hausarrest, Tonband- und Fernsehverbot, in der die Eltern ihrem Kind unwissentlich den Schrecken der einst selbst erlittenen Trennung als unentwegte Drohung weitergeben. Eine Kindheit, in der ein Sonntag klar strukturiert, die Kittelschürze für die Hausfrau unabdingbar und die von Erwachsenen erdachte Mondfahrt Peterchens ein Horrorszenario ist wie das der Mainzer Fastnacht. Wie sehr sich das individuell Erlebte und kollektiv Erfahrene gegenseitig durchdringen, zeigt sich, wenn Witzel gerade nicht die inszenierten Bilder aus dem Familienalbum "Unser Kind", sondern vielmehr die ausgesonderten Aufnahmen mit der Frage zur Hand nimmt, ob nicht sie es sind, die Auskunft darüber geben können, wie etwas wirklich gewesen ist. Im unentwegten Zweifel am Wahrheitsgehalt der eigenen Erinnerungen zeigt sich Frank Witzel einmal mehr als ein so nahbarer wie begnadeter Erzähler, dem es gelingt, über das Persönliche die Verfasstheit einer Nachkriegsgesellschaft in der neuen BRD zu erfassen.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.