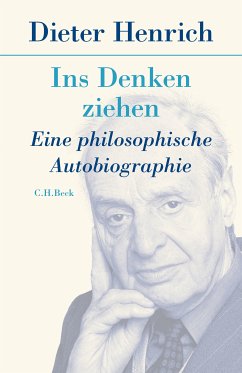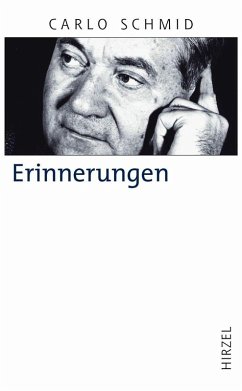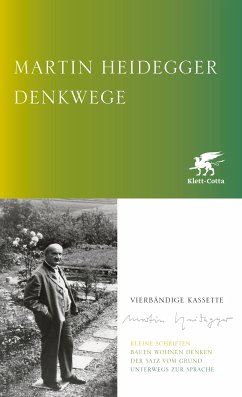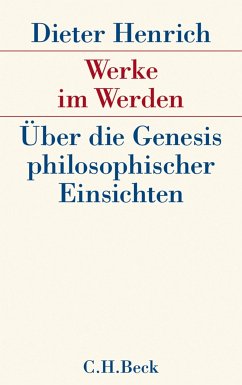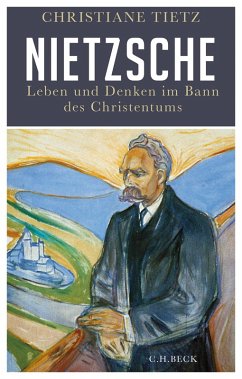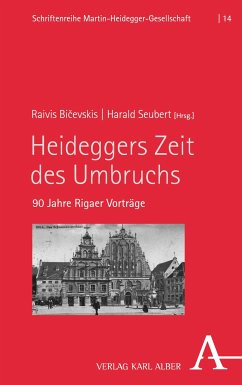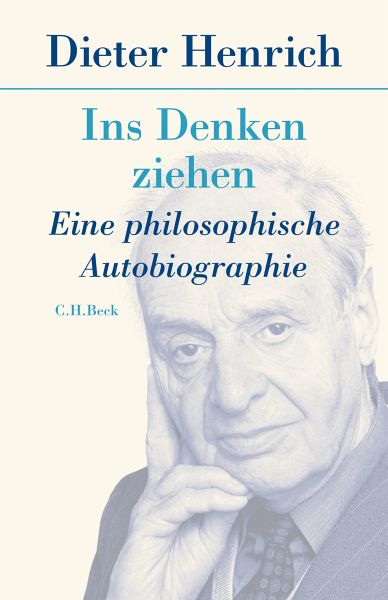
Ins Denken ziehen (eBook, PDF)
Eine philosophische Autobiographie
Redaktion: Bormuth, Matthias; Bülow, Ulrich
Sofort per Download lieferbar
Statt: 28,00 €**
21,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Dieter Henrich ist weltweit bekannt als Erforscher des deutschen Idealismus und Philosoph der Subjektivität. In Gesprächen mit Matthias Bormuth und Ulrich von Bülow resümiert er die Stationen seines Wegs zur und in der Philosophie, den Gang seines Denkens sowie die Begegnungen mit Lehrern, Zeitgenossen und Weggefährten. Dazu zählen Hans-Georg Gadamer, Martin Heidegger, Theodor W. Adorno, Hilary Putnam oder auch Sergiu Celibidache und Alexander Mitscherlich, der ihm nach einigen Sitzungen bescheinigte, keine Psychoanalyse zu benötigen. Als Kind ist er lange Zeit schwer krank gewesen. Heu...
Dieter Henrich ist weltweit bekannt als Erforscher des deutschen Idealismus und Philosoph der Subjektivität. In Gesprächen mit Matthias Bormuth und Ulrich von Bülow resümiert er die Stationen seines Wegs zur und in der Philosophie, den Gang seines Denkens sowie die Begegnungen mit Lehrern, Zeitgenossen und Weggefährten. Dazu zählen Hans-Georg Gadamer, Martin Heidegger, Theodor W. Adorno, Hilary Putnam oder auch Sergiu Celibidache und Alexander Mitscherlich, der ihm nach einigen Sitzungen bescheinigte, keine Psychoanalyse zu benötigen. Als Kind ist er lange Zeit schwer krank gewesen. Heute erkennt er darin einen der Gründe, warum die Philosophie zu seiner Lebensaufgabe wurde. Dieter Henrichs philosophische Autobiographie ist reich an prägnanten Erinnerungen an Personen und Begebenheiten in vielen Lebenssphären und Weltgegenden. Er wurde zu einem der einflussreichsten Philosophen seiner Zeit, mit einer ergebnisoffenen, undogmatischen Philosophie, in der die Freiheit des Subjekts als eine ermöglichte und nicht als eine aus Selbstmacht initiierte verstanden wird. In mit großer Offenheit geführten Gesprächen lernen wir einen eleganten, altersweisen Metaphysiker ohne System und ohne Lehrsätze kennen, der der menschlichen Subjektivität in ihrem Glück und ihren Nöten, ihren Wirrungen und befreienden Momenten nachgeht und dabei die Perspektiven und Konflikte erkundet, in die ein Denken zieht, das den Mut hat, sich auch letzten Fragen auszusetzen.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.