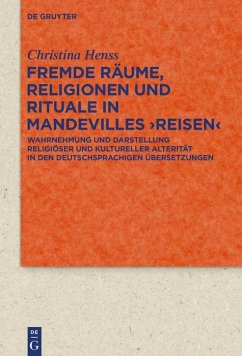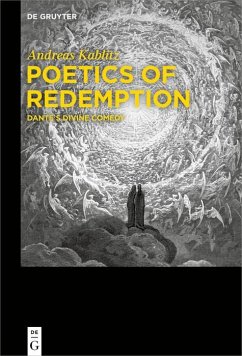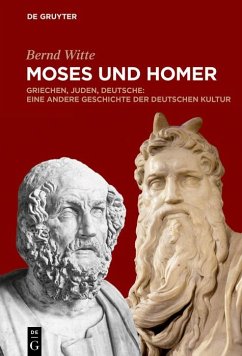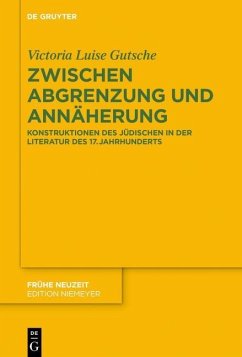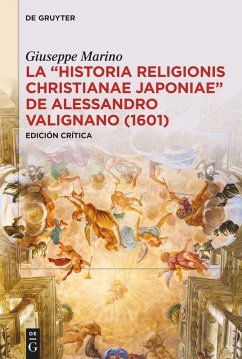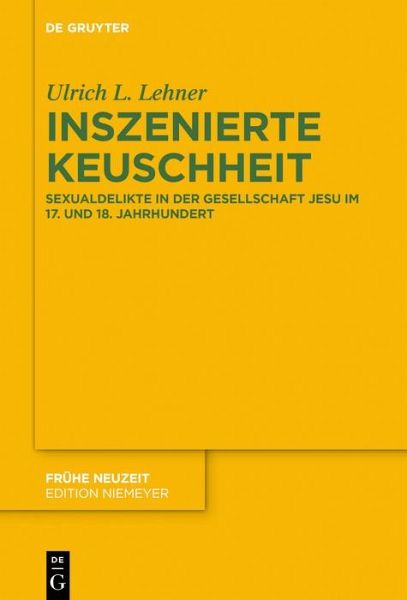
Inszenierte Keuschheit (eBook, ePUB)
Sexualdelikte in der Gesellschaft Jesu im 17. und 18. Jahrhundert

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Die historische Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch und Gewalt in der Frühen Neuzeit steht noch ganz am Anfang. Auf detaillierten Archivrecherchen beruhend, geht diese Studie Sexualdelikten im Jesuitenorden nach, die an Schülern, Studenten, Beichtkindern und anderen Jesuiten verübt worden sind. Dabei werden Muster von sexueller Gewalt deutlich, die sich auf spirituelle Bereiche ausdehnten, aber von den Ordensoberen nur in Extremfällen geahndet wurden. Dieser Ansatz ermöglicht es, ein neues Licht auf die Geschichte jesuitischer Bildungs- und Seelsorgeeinrichtungen zu werfen.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.