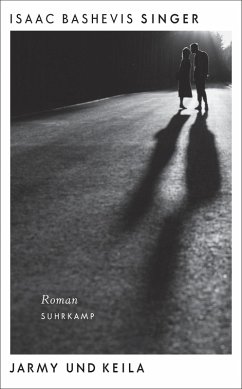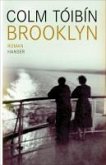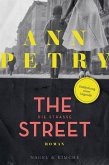»Eine wunderbare, wunderbare Welt, diese schrecklich schöne Welt von Isaac Bashevis Singer!« Henry Miller
»Es kam selten vor, dass eine Frau, die schon in drei Bordellen gearbeitet hatte, noch heiratete ... Es war ein Omen für alle Warschauer Huren, nicht die Hoffnung aufzugeben, ein Zeichen, dass die Liebe noch immer die Welt regierte.«
Warschau 1911: Keila - die bereits mehrere Stationen in Bordellen hinter sich hat - findet in Jarmy, dem Ex-Häftling, ihre große Liebe. Das junge Ehepaar sehnt sich nach einem Leben außerhalb des jüdischen Gettos, in dem der Alltag von Armut und der Angst vor Pogromen geprägt ist. Dieser Traum scheint plötzlich zum Greifen nahe: Max, ein alter Bekannter, will in Amerika das große Geld machen - das Paar soll ihm dabei helfen. Keila soll junge Mädchen für die Bordelle in der Neuen Welt anwerben. Max selbst fühlt sich zu Jarmy hingezogen, dem er schon früher näherkam. Es entfaltet sich eine verhängnisvolle Dreiecksbeziehung. Da tritt der schüchterne und unerfahrene Bunem in ihr Leben, der sich auf ein Leben als Rabbiner vorbereitet. Für Keila, die er glühend verehrt, ist er bereit, mit allen Konventionen des Schtetls zu brechen. Werden die beiden in Amerika ihr Glück finden?
»Es kam selten vor, dass eine Frau, die schon in drei Bordellen gearbeitet hatte, noch heiratete ... Es war ein Omen für alle Warschauer Huren, nicht die Hoffnung aufzugeben, ein Zeichen, dass die Liebe noch immer die Welt regierte.«
Warschau 1911: Keila - die bereits mehrere Stationen in Bordellen hinter sich hat - findet in Jarmy, dem Ex-Häftling, ihre große Liebe. Das junge Ehepaar sehnt sich nach einem Leben außerhalb des jüdischen Gettos, in dem der Alltag von Armut und der Angst vor Pogromen geprägt ist. Dieser Traum scheint plötzlich zum Greifen nahe: Max, ein alter Bekannter, will in Amerika das große Geld machen - das Paar soll ihm dabei helfen. Keila soll junge Mädchen für die Bordelle in der Neuen Welt anwerben. Max selbst fühlt sich zu Jarmy hingezogen, dem er schon früher näherkam. Es entfaltet sich eine verhängnisvolle Dreiecksbeziehung. Da tritt der schüchterne und unerfahrene Bunem in ihr Leben, der sich auf ein Leben als Rabbiner vorbereitet. Für Keila, die er glühend verehrt, ist er bereit, mit allen Konventionen des Schtetls zu brechen. Werden die beiden in Amerika ihr Glück finden?
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, I ausgeliefert werden.

Eine beinahe perfekte Memorialisierung der zerstörten polnisch-jüdischen Gemeinde? "Jarmy und Keila", ein bislang unbekannter Roman Isaac B. Singers
"In der Literatur muss es mehr Fakten und Ereignisse als Gedanken geben. Wenn es mehr Gedanken als Fakten gibt, kann man es zwar als Strom des Bewusstseins bezeichnen, ich würde es aber eher einen Strom der Langeweile nennen." Diesen Satz soll Isaac B. Singer oft wiederholt haben, behauptet seine polnische Biographin Agata Tuszynska, und wenn man seine Prosa liest, kann man sich das sehr gut vorstellen. Dazu bietet sich auch gerade eine neue Gelegenheit, denn soeben ist, erstmals auf Deutsch, Singers Roman "Jarmy und Keila" erschienen, in dem es von Fakten und Ereignissen nur so wimmelt.
Schauplatz des ersten Teils der Handlung, die im Jahre 1911 einsetzt, ist das Warschauer jüdische Viertel, vor allem die dortige Krochmalna-Straße, die Singer, der dort jahrelang gewohnt hatte, bestens vertraut war. Eine Straße, in der fromme Juden wie sein Vater, ein chassidischer Rabbiner, anzutreffen sind, in der es aber auch Bordelle und Kneipen gibt, wo einem schon im Morgengrauen ein Bier- und Wodkadunst entgegenweht und wo Typen herumsitzen, die Fettkloß Reitzele, Noah Schaufel, Shaya Schlägel oder Itsche Einauge heißen. Die jüdische Unterwelt Warschaus.
Auch die beiden Titelhelden sind keine Heiligen: Keila ist eine Prostituierte, Jarmy ein Dieb und Menschenhändler, der gerade eine Gefängnisstrafe abgesessen hat. Die beiden sind miteinander glücklich verheiratet und fest entschlossen, woanders ein neues, anständiges Leben zu beginnen. Davon scheinen sie auch nicht weit entfernt zu sein, allerdings nur so lange, bis in Warschau der Lahme Max auftaucht - ein Gauner und Zyniker, der seinerzeit von hier nach Amerika gegangen und dort zu Geld gekommen ist. Nun ist er zu seinem eigenen Erstaunen wieder da. "Die Toten kommen zurück, und ich bin wieder auf dem Platz in Warschau, in der Potocka, in der Shuletz und was weiß ich wo noch", wundert er sich. Hinter seiner Rückkehr steckt aber ein Plan: Er will in Südamerika das große Geld machen, und Keila und Jarmy sollen ihm dabei helfen - sie junge Mädchen für die dortigen Bordelle anwerben, er als ihr Zuhälter arbeiten.
Obwohl äußerlich genauso hässlich wie vom Charakter her, hat Max einen riesigen sexuellen Appetit, und zwar sowohl auf Männer als auch auf Frauen, was dem jungen Paar zum Verhängnis wird. Zunächst versucht er, Jarmy mit seinen erotischen Avancen für die Vision der Partnerschaft in Südamerika zu gewinnen, dann vergewaltigt er Keila. Er tut es ausgerechnet an Jom Kippur, was die junge Frau so verstört, dass sie den Rabbi Menachem Mendel aufsucht: Sie möchte für ihre Sünden Buße tun. Der Rabbi verordnet ihr die Pflege eines alten, kranken Mannes, und da sie den Weg zu ihm nicht kennt, gibt er ihr als Führer seinen Sohn Bunem mit.
Damit tritt ein weiterer Mann in Keilas Leben, der auch eine viel interessantere Romanfigur abgibt als der seltsam blasse Jarmy - vielleicht weil er einiges vom Autor und gleichzeitig von seinem älteren Bruder, Israel J. Singer an sich hat. Bunem ist einerseits, wie Isaac, schüchtern, unerfahren und bemüht, den Erwartungen seines Vaters gerecht zu werden. Andererseits rebelliert er, wie Israel, gegen das Elternhaus, das er als eng und freudlos empfindet, und will das Leben eines freien Künstlers führen, was er auch - indem er sich mit einigen Malern ein Atelier teilt - heimlich tut. Durch die Begegnung mit Keila, deren spontane, leidenschaftliche Art ihn fasziniert und die ihm auch bald "alle Geheimnisse und Kapricen des Körpers zeigt", findet er den Mut, mit der alten Umgebung endgültig zu brechen. Er beschließt, mit ihr nach Amerika zu gehen, zumal er in Warschau für sich keine Zukunft sieht.
Und so spielt der zweite Teil des Romans in New York, wo das ungleiche Paar, der Rabbinersohn und die Hure, im jüdischen Viertel an der Lower East Side, einen Neuanfang versuchen. Doch keiner von ihnen kommt in der neuen Realität richtig an. Weder Keila, die zwar mit der Zeit Arbeit in einer Bäckerei findet, für die sie in den Straßen des Viertels frische Brötchen feilbietet, ansonsten aber mit der fremden Sprache und Umgebung nicht zurechtkommt. Noch Bunem, sosehr er sich auch darum bemüht. Er versucht, sich selbst Englisch beizubringen, und nimmt jeden Job an, der sich bietet. Dennoch fühlt sich für ihn alles irgendwie falsch an, sogar seine Arbeit als Lehrer in einem Talmud-Tora-Lehrhaus, denn die Kinder können nur wenig Jiddisch, nehmen den Unterricht nicht ernst und scheinen nur eine einzige jüdische Zeremonie zu kennen: "die Feier der Bar Mitzwa". Erst als er Anstellung als Vorleser bei einem reichen, blinden Juden findet, kommt er ein wenig zur Ruhe. Mit der ist es aber bald vorbei, denn Jarmy taucht in New York auf und fordert seine Rechte als Ehemann ein, woraufhin Keila aus Bunems Leben verschwindet. Als sie sich irgendwann wiederbegegnen, scheint sie nur noch eins zu verbinden: der Wunsch, ihrem Dasein ein Ende zu setzen.
"Jarmy und Keila" erschien vom Dezember 1976 bis Oktober 1977 als Fortsetzungsroman in der New Yorker jiddischen Zeitung "Forverts", in der Singer, ähnlich wie sein Bruder, jahrzehntelang seine Texte publizierte. Im folgenden Jahr 1978, in dem er den Nobelpreis für Literatur bekam, erschien sein Roman "Schoscha" (dt. 1980), der, so Jan Schwarz in seinem Nachwort, "eine beinahe perfekte Memorialisierung der zerstörten polnisch-jüdischen Gemeinde" gewesen sei, was Singers Entscheidung zur Folge gehabt habe, auf die Veröffentlichung der englischen Fassung von "Jarmy und Keila" zu verzichten. Und im Endeffekt auch darauf, die in "Forverts" erschienenen Folgen zu überarbeiten und eine endgültige Version des Romans zu schreiben.
Über die Frage der perfekten Memorialisierung ließe sich sicher diskutieren, doch davon abgesehen: Der Roman hat durchaus seine Stärken - er zeichnet ein breites, detailreiches Gesellschaftspanorama jener Zeit nach, zeigt unbeschönigt das jüdische Milieu Warschaus und New Yorks, gibt überzeugend die Ängste und Hoffnungen der damaligen Migranten wieder, womit er für die Situation der heutigen sensibilisiert. Auf der anderen Seite aber machen sich die ausgebliebene Überarbeitung und die ursprüngliche Bestimmung des Romans auf eine Art bemerkbar, die für Momente der Ungeduld oder der Belustigung sorgt. Es gibt Längen und Wiederholungen, und manche Szenen und Dialoge haben etwas von der Trivialität oder Melodramatik jenes Dreigroschenromans, auf dessen Tradition das Buch basiert. Etwa Keilas Verhalten, das oft etwas vom effektheischenden Agieren der Stummfilmstars an sich hat: "Keila wies anklagend mit dem Finger auf Bunem. Schaum stand ihr vor dem Mund, als hätte sie einen epileptischen Anfall. Sie hatte den Blick einer Wahnsinnigen, verdrehte die Augen so, dass man nur noch das Weiße sah." Auf Singers Zeitgenossen mögen solche Szenen eine ungeheuer starke Wirkung gehabt haben, für den heutigen Leser haben sie eher ungewollte Komik. Und auch "die Kraft zu schockieren", die der Nachwortverfasser verspricht, kann man dem Roman nur dann attestieren, wer von der Existenz einer jüdischen Unterwelt im Vorkriegswarschau nicht gewusst hat.
In diesem Fall sollte man allerdings zwei Romane gleichzeitig lesen: Singers "Jarmy und Keila" und Szczepan Twardochs "Der Boxer" (dt. 2018), der im Warschau der späten dreißiger Jahre, genauer: in der polnisch-jüdischen Unterwelt spielt. Denn wenn man es tut, merkt man plötzlich, wie durch Twardochs modernen, oft wirklich schockierenden Stil auch Singers Buch an Kraft und Härte gewinnt. Und zudem, dass dies zwei Teile einer und derselben Geschichte sind, in denen zwar die Grenze zwischen Realität und Fantasie gleichermaßen schwer auszumachen ist, die aber dennoch ein doppelter Beweis dafür sind, dass diese Welt einst tatsächlich existierte.
MARTA KIJOWSKA
Isaac Bashevis Singer:
"Jarmy und Keila". Roman.
Aus dem amerikanischen Englisch von Christa Krüger. Mit einem Nachwort von Jan Schwarz. Jüdischer Verlag im Suhrkamp Verlag, Berlin 2019. 464 S., geb., 26,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»[Der Roman] zeichnet ein breites, detailreiches Gesellschaftspanorama jener Zeit nach, zeigt unbeschönigt das jüdische Milieu Warschaus und New Yorks, gibt überzeugend die Ängste und Hoffnungen der damaligen Migranten wieder, womit er für die Situation der heitigen sensibilisiert.« Marta Kijowska Frankfurter Allgemeine Zeitung 20190709