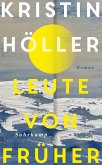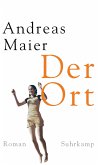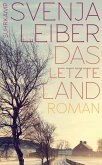Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, I ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH

Thomas Kapielskis Roman "Je dickens, destojewski!" erzählt von Bier-Expeditionen nach Spandau und Bamberg
Der Stammtisch - das schrieb nach dem Krieg kein Geringerer als der Sozialphilosoph Max Horkheimer - sei nun auch nicht mehr der alte, nämlich jener "vielgeschmähte Stammtisch, von dem Strindberg sagt, dass man ihn ehrfürchtig behandeln solle, weil der Mensch gerade dort zur Demokratie komme". Und schon in der legendären "Zeitschrift für Sozialforschung" hatte Horkheimer darauf hingewiesen, dass die "phantasierte Identität - dies gilt von den neukantianischen Philosophiesystemen bis herab zum Stammtisch - erst gestiftet" werden müsse. Ungefähr so mag dies auch Thomas Kapielskis Meinung sein. Nur dass bei ihm zwischen den philosophischen Systemen und dem Stammtischgespräch nicht mehr Dialektik, sondern Identität waltet.
Es geht nach Spandau zum "Büttelmann" (mit Schultheissens Bieren) und nach Bamberg, wo man in der Fässla-Brauerei (früher "Fäßla", die Rechtschreibung wurde zu Kapielskis Leidwesen auch dort reformiert) einkehrt, gelegentlich auch zur Aral-Tankstelle am Scholzplatz im Berliner Westend. Fragen wir nun aber mit Horkheimer nach der Identitätsstiftung am Stammtisch, so wird es gleich vertrackt. Denn die beiden Tische, der beim Büttelmann und der Bamberger, stehen in einem eigentümlichen Spiegelverhältnis: Hier wie dort gibt es eine ansehnliche Bedienung: Susi in Spandau und Vreni im "Fässla". Der Spandauer Oberkommissar a. D. heißt Markulf Kräuter, der Bamberger Oberhauptkommissar ("Forensiker") Rochus Röhr. Hier ein Reformhausbetreiber, dort ein Reformschuhfabrikant. Hier ein Forstadjunkt (später "Staats- und Forstrat", auch "Forstfähnrich"), dort ein Bibliotheksdiener namens Hekel, der auf Hegel schwört. In Bamberg eine "Hartzvierette" (La Vierette, Hartzi), in Spandau der ewig schweigende Karl Schramm.
Bei der Tankstelle aber treffen sich regelmäßig Ernst L. Wuboldt - der Held des Romans, er muss nun endlich vorkommen! - und seine beiden Freundinnen Murmel (rundlich) und Spindel (schmal) zum Flaschenbier. "Unter den Töchtern des Landes finden sich kaum eigenartigere und schmuckere Mädchen als die zwei! Und unter den Tankstellen des Landes kaum eine scharmantere als diese eine!" Beide bekommen von Wuboldt Ansichtskarten aus Bamberg. Wenn wir es richtig sehen, tauchen auch weder Murmel (Mathematikerin, beschäftigt bei einer Glücksspielfirma, sie nennt Wuboldt "Örni") noch Spindel (sie nennt ihn "Wu") jemals beim Büttelmann oder im "Fässla" auf - nie, erst am bösen, bitteren Ende des Romans.
Aber ist es ein Roman? Jawohl und durchaus. Er reflektiert sich selbst, wie man's seit der Romantik nicht mehr erlebt hat, seit Brentanos "Godwi" (wo der Autor im zweiten Teil Gespräche mit dem Helden des ersten führt) oder bei Tieck im "Gestiefelten Kater", wo von der Bühne herunter mit dem Publikum disputiert wird. Schalten wir gleich eine dieser Reflexionen ein: ",Titel und Überschrift, muss das sein?' fragte Wuboldt und antwortete gleich selbst: ,Ja, doch!' ,Muss sein, wa?!' meinte Murmel beipflichtend. ,Aber eine Vorrede?' ,Wer braucht'n sowat?' zweifelte selbst Murmel."
Als sei es noch nicht kompliziert genug, kommt eine weitere Figur ins Spiel, der Autor nämlich, ein gewisser Pohle, der im Personenverzeichnis schnöde als "Schreibkraft" oder "Pollack" firmiert. Auch "Kapielski" klingt ja polnisch, und so sind den romantheoretisch informierten Auslegungskünsten der Leser keine Grenzen gesetzt. Pohle ist mächtig, was die Geschichte angeht - er verbindet irgendwann den Wuboldt mit einer Ehegattin, dem "Bucker", die so ziemlich aus dem Nichts auftaucht -, aber auch er hat nicht alles unter Kontrolle, wie sich am plötzlichen, bösen, bitteren Ende erweist.
Dies ist aber noch keineswegs erreicht, als Wuboldt das Bucker (auch "Buckerli" und "Buckerlein" genannt, gelegentlich "Lindwurm", also Drache) über den Haufen schießt. Ihr wird, von Gnaden des Pohle, eine wunderbare Auferstehung zuteil. Unter all diesen Figuren wird gediegenste Philosophie verhandelt - mit Murmel kommen auch mathematische Probleme zur Sprache -, wie dies an Stammtischen der Brauch ist. Vornehmlich also redet man über Dinge wie den Untergang des Abendlandes, Deutschheit und deren Zukunft, Gegenwartskunst, grünen Meinungsterror und "Veggie Day".
Einmal fehlt Wuboldt beim Büttelmann. "Eben lud Susi Getränke ab. ,Was wohl der Ernst gerade macht?' ,Na, das möchte ich auch mal gern wissen!' sprach der Reformfabrikant. Hekel und Schramm nickten, zudem Kräuter die Schultern hob und ,Ich auch, ich auch!' sagte. (Und wir, Leser? Wir wollen das aber auch gern mal wissen!)" Wer mehr, nein: alles über Ernst L. Wuboldt wissen will, der greife vertrauensvoll zu Kapielskis Roman.
LORENZ JÄGER
Thomas Kapielski: "Je dickens, destojewski!" Ein Volumenroman.
Suhrkamp Verlag, Berlin 2014. 458 S., br., 20,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main