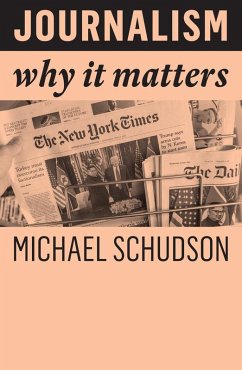Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Ein Medienhistoriker gibt auch traditionellen Presseorganen eine Zukunft - zumindest einigen.
Von André Kieserling
Für düstere Prognosen über die Zukunft der Pressewelt gibt es einen quantitativen Anhaltspunkt: Immer mehr Leser informieren sich lieber im Internet als per Zeitungslektüre, und das dadurch ausgelöste "Zeitungssterben" ist beunruhigend genug.
Nun kann man die Leser der Zeitungen nicht nur zählen, sondern auch gewichten. Das erste Verfahren setzt als Bedingung der Zählbarkeit die Gleichheit aller Leser voraus, also auch ein künstliches Absehen von allem, was diese Leser sonst noch darstellen und sind. Auch auf die Ungleichheiten in der Größe des Kontaktnetzes der Leser und ihrer eigenen Stellung in ihm kommt es nicht an. Das zweite Verfahren macht diese "demokratische Abstraktion" wieder rückgängig, und dabei stellt sich heraus, dass einige Zeitungsleser ein eigenes Publikum haben, das ihrem Urteil vertraut. Eine Zeitung, der es gelingt, solche einflussreichen Leser an sich zu binden, kann ihren eigenen Einfluss multiplizieren. Da auf diesem Umweg auch kleine Blätter eine große Wirkung entfalten können, sind Auflage und Reichweite nicht das Maß aller Dinge. Das Zentrum des Systems muss nicht besonders groß sein.
Auf der Suche nach solchen Multiplikatoren hatte die Forschung zunächst nur an die informalen "Meinungsführer" kleiner Gruppen gedacht. Später kam der Gedanke hinzu, zu den Lesern der einen Zeitung könnten immer auch die Journalisten der anderen gehören, also begann man, sich für die Lieblingszeitungen dieser Berufsgruppe zu interessieren. Seither weiß man, dass es in jedem Land eine winzige Gruppe von überregionalen Blättern gibt, inzwischen alle mit eigener Online-Redaktion, aus denen die Journalisten aller anderen Organe, Rundfunk und Fernsehen eingeschlossen, einen großen Teil ihrer Informationen und Situationsdefinitionen beziehen. In Deutschland gehören zu diesen sogenannten "Leitmedien" etwa der Spiegel, die Zeit, die Süddeutsche Zeitung, die F.A.Z.
Einer der besten Kenner der Geschichte des amerikanischen Journalismus, der Historiker und Soziologe Michael Schudson von der Columbia University, hat nun ein kleines Buch vorgelegt, das jene alarmierenden Prognosen einer kritischen Prüfung unterzieht. Während Schudson den in Amerika kaum rezipierten Begriff des Leitmediums nicht verwendet, eignet er sich wie kein anderer, die in lockerer Folge präsentierten Argumente des Bandes zu resümieren. Denn nicht auf die gezählten, sondern auf die gewichteten Leser kommt es ihm an.
Schudson erinnert zunächst an einen gesicherten Befund über Innovationen wie Schrift, Buchdruck oder Telekommunikation. Danach verdrängt das neue Verbreitungsmedium nicht etwa die alten, sondern präzisiert nur die Bedingungen ihrer Attraktivität und ihres Gebrauchs. So hat der raschere Rundfunk die Tageszeitung nicht etwa verdrängt, wohl aber hat er sie gelehrt, neben den Nachrichten, die das Publikum immer schon kennt, wenn sie erscheinen, auch die Kommentare dazu zu bieten; auch die Wochenzeitungen werden ja nicht um ihrer Nachrichten willen gelesen.
Den bestimmenden Einfluss im Bereich dieser Kommentare und Hintergrundinformationen sieht Schudson nach wie vor bei den Profis der Printmedien konzentriert, denen der Gelegenheitsjournalist keine ernsthafte Konkurrenz mache. Die Bestseller unter den Sachbüchern über Krisen- und Kriegsgebiete stammen nicht von "Bürgerjournalisten", die allenfalls Situationseindrücke verallgemeinern könnten, sondern von erfahrenen Auslandskorrespondenten.
Aber nicht nur im Bereich der Kommentare, auch bei den Nachrichten neigt Schudson zu vorsichtigem Optimismus. Gewiss gebe es für das Produkt Nachricht unterdessen eine Vielzahl von neuen Verbreitungswegen, aber die Produzenten seien doch nach wie vor die alten: der Schwerpunkt der Recherchetätigkeit liege bei Reportern, die für Agenturen und Zeitungen arbeiten. Alle anderen "Quellen" lebten, was die Herkunft und vor allem die Vertrauenswürdigkeit ihrer Meldungen betrifft, aus zweiter Hand. In Amerika scheint dies, anders als in Europa, bereits für die Fernsehjournalisten zu gelten, auch wenn die Fernsehzuschauer dies nicht immer wissen. Schudson erläutert dies an folgendem Beispiel: Wenn es Nachrichten über Fehlverhalten im Amt gibt, über die Spitzenpolitiker stürzen, dann stammen sie auch heute noch aus den Zeitungen - und nicht aus dem Fernsehen, das sie allseits bekannt macht. Für den bleibenden Einfluss zuverlässig recherchierter Berichterstattung ist also die bloße Anzahl der Zeitungsleser kein zuverlässiges Maß. Selbst auf einige Blätter mehr oder weniger kommt es Schudson zufolge nicht an. Sollte dies zutreffen, dann wäre es eine schlechte Nachricht für die Zeitungen - und eine gute für den Journalismus.
Michael Schudson, Journalism: Why It Matters, Cambridge 2020
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Pablo Boczkowski, Northwestern University
"This book is vintage Schudson. A concise, matter-of-fact recitation of why we should care about journalism, it will top syllabi everywhere in explaining journalism's singular importance and in nurturing its future survival."Barbie Zelizer, University of Pennsylvania