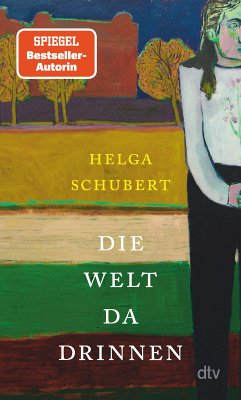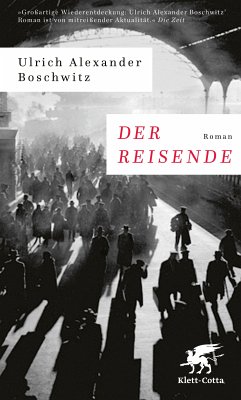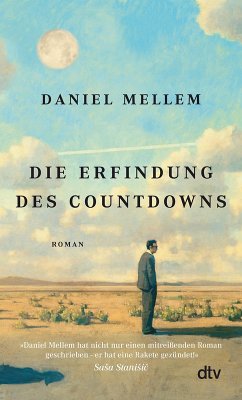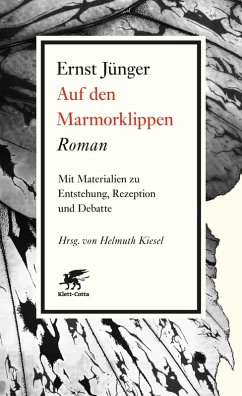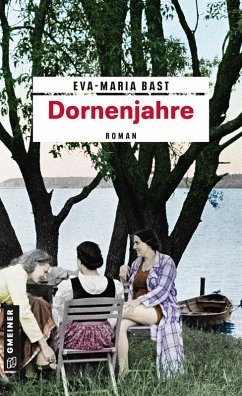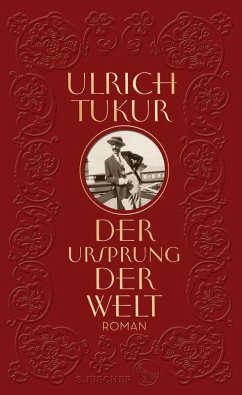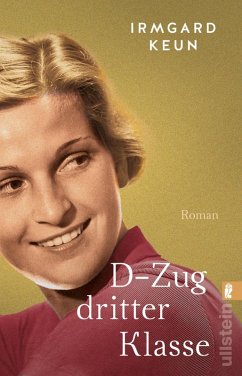Judasfrauen (eBook, ePUB)
Zehn Fallgeschichten weiblicher Denunziation im Dritten Reich
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 11,00 €**
9,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Broschiertes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
"Die Diktatur ist die Täterin." Judas als Frau, Frauen als Verräterinnen - in ihrem dokumentarischen Werk erzählt Helga Schubert von zehn Frauen, die im Dritten Reich zu Denunziantinnen geworden sind. Aus Gerichtsakten rekonstruiert die Autorin die tödliche Beziehung der Verräterinnen zu ihren Opfern, geht mit den Mitteln der Literatur auf eine Spurensuche nach weiblicher Täterschaft und destilliert daraus irritierende Parabeln des Verrats. Diesen Verrat hat Helga Schubert »aufgehoben wie ein verwelktes Blatt. Und wie unter einem Mikroskop sah ich eine Struktur, die sich immer und immer...
"Die Diktatur ist die Täterin." Judas als Frau, Frauen als Verräterinnen - in ihrem dokumentarischen Werk erzählt Helga Schubert von zehn Frauen, die im Dritten Reich zu Denunziantinnen geworden sind. Aus Gerichtsakten rekonstruiert die Autorin die tödliche Beziehung der Verräterinnen zu ihren Opfern, geht mit den Mitteln der Literatur auf eine Spurensuche nach weiblicher Täterschaft und destilliert daraus irritierende Parabeln des Verrats. Diesen Verrat hat Helga Schubert »aufgehoben wie ein verwelktes Blatt. Und wie unter einem Mikroskop sah ich eine Struktur, die sich immer und immer und immer wiederholt.«
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.