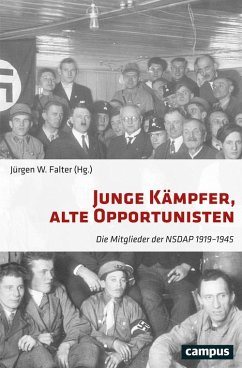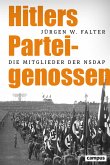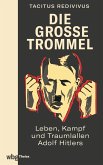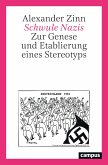Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH

Die Mitglieder der NSDAP: Immerhin traten 750 000 "Parteigenossen" bis zum Kriegsende 1945 sogar wieder aus
Dass Opa kein Nazi gewesen sei, gehörte nach 1945 zu den wenigen Gewissheiten, die landauf, landab an deutschen Küchentischen zu hören waren. Die Familiengeschichten, die häufig von Krieg und Entbehrung, nicht selten von Flucht und Vertreibung, bisweilen von Opposition und Widerstand, aber kaum je von Irrtum und Opportunismus handelten, schufen eine eigene Wirklichkeit. Und Kinder wie Enkelkinder hatten - aus den verschiedensten Gründen - oftmals nur geringes Interesse, die entsprechenden Sagbarkeitsregeln zu durchbrechen. Zur Realität gehörten freilich auch die vielen Hitler-Anhänger, die dem "Führer" selbst nach Stalingrad unbeirrt die Treue hielten. Zur Realität gehörte die individuelle Verstrickung in die nationalsozialistischen Verbrechen und nicht zuletzt der Umstand, dass die NSDAP bei Kriegsende rund 8,8 Millionen Mitglieder zählte.
Wenn man über die Struktur dieser Partei, die nicht allein der deutschen Geschichte ihren düsteren Stempel aufgedrückt hat, beinahe ebenso wenig weiß wie von Opa, der partout kein Nazi gewesen sein wollte, so muss das geradezu für Irritationen sorgen - unter Historikern ebenso wie beim großen Publikum. An Geschichten herrschte dabei, ähnlich wie beim Familiengespräch am Küchentisch, bereits seit den 1950er Jahren kein Mangel: Die einen sahen in der NSDAP ein Instrument der "Bourgeoisie", die anderen wollten in ihr eine Partei der kleinen Leute erkennen, wieder andere interpretierten sie als ein Phänomen des Mittelstands. Schlüssig belegen ließ sich indes keine dieser Deutungen - in der Regel blieb es bei Mutmaßungen.
Umso bedeutender sind die Befunde dieses Sammelbands, der die Ergebnisse eines von Jürgen W. Falter geleiteten Projekts präsentiert, das die Mitglieder der NSDAP zwischen 1925 und 1945 untersucht. Gemessen an dem unheimlichen Erfolg, den die NSDAP - personell im Schnitt zehnmal stärker als CDU oder SPD zu ihren besten Zeiten - ohne Zweifel hatte, wusste man bislang erstaunlich wenig über diese Partei. Nun treten auf der Basis mehrerer Stichproben, die Falter und sein Team aus den 12 Millionen Mitgliedskarten der NSDAP-Zentralkartei gezogen haben, hochinteressante Phänomene zutage. Zu ihnen zählt beispielsweise die Tatsache, dass rund 60 Prozent der Mitglieder, die zwischen 1925 und 1929 der NSDAP beigetreten waren, sie anschließend wieder verließen und bis Kriegsende insgesamt über 750 000 Mitglieder aus der Partei austraten.
Wenn die NSDAP im Jahr 1934 sogar einen effektiven Mitgliederschwund zu verzeichnen hatte, so hing dies mit der ebenfalls nicht sonderlich bekannten Tatsache zusammen, dass die Partei - nach dem gewaltigen Ansturm neuer Mitglieder seit dem 30. Januar 1933, der die Zentrale völlig überforderte und die Struktur der NSDAP drastisch zu verändern drohte - zum 1. Mai 1933 eine regelrechte Aufnahmesperre verhängte. Für jedermann, will sagen: für "unbescholtene" Deutsche "arischer Abstammung" war die NSDAP nach der Machtübernahme ausschließlich zwischen 1939 und 1942 geöffnet. Insgesamt wurde die Partei - so die klare These des Buchs - nach 1933 aus einer Bewegung "junger Kämpfer" zu einer Massen- und Staatspartei, die vornehmlich aus "alten Opportunisten" bestand.
Jürgen Falter und sein Team beschäftigen sich freilich nicht nur mit dem Mitgliederboom nach Hitlers Regierungsantritt. Sie wenden sich etwa auch den weiblichen NSDAP-Mitgliedern zu, unter denen ledige Frauen zwischen 25 und 39 Jahren besonders ins Gewicht fielen. Sie analysieren die Bedeutung von Parteiausschlussverfahren, betrachten den Alterungsprozess der Mitglieder und heben insgesamt den heterogenen Charakter der Partei hervor - der Arbeiteranteil unter den Neumitgliedern lag während der Weimarer Republik bei durchschnittlich 40 Prozent. "Extremismus des Mittelstandes"? Fehlanzeige.
Ob jedes NSDAP-Mitglied ein überzeugter Nazi war, lässt sich mit den Methoden der Politikwissenschaft gewiss nicht entscheiden. Zu Recht erinnert Falter daran, dass es glühende Nationalsozialisten auch außerhalb der NSDAP gab, beispielsweise unter Wehrmachtsangehörigen, und die individuellen Beitritts- oder Austrittsmotive anhand von Mitgliedskarten ohnehin nicht zu ermitteln sind. "Typische NSDAP-Mitglieder", so resümiert Falter denn auch vorsichtig, "dürften folglich eher die opportunistischen Mitläufer als die weltanschaulich 150-prozentig Überzeugten gewesen sein."
Die Menschen aber, die sich hinter den Mitgliedsnummern verbergen, bleiben in diesem Buch notgedrungen blass. Ihre Motive, ihre Erwartungen und Enttäuschungen, ihre Sorgen und Ängste sind durch statistische Verfahren schlechterdings nicht zu entschlüsseln. Das ist auch den Autoren bewusst, die ihre Daten punktuell mit persönlichen Zeugnissen zu korrelieren versuchen - insbesondere mit Theodore Abels Auswertung von 700 Lebensschilderungen "alter Kämpfer" aus dem Jahre 1937. Über die Erkenntnis, dass gerade diese Parteigenossen durch die vielen neuen Mitglieder eine "Verbonzung" befürchteten und den Markenkern der NSDAP bedroht sahen, gelangen sie dabei freilich kaum hinaus.
Eine solche Einschränkung schmälert nicht den Ertrag dieses ungemein instruktiven, allerdings nachlässig lektorierten Sammelbands. Er macht Appetit auf Falters bereits angekündigte Gesamtdarstellung, in der die Mosaiksteinchen, die die Autoren hier präsentieren, in einem größeren Kontext zu betrachten sein werden. Vor allem aber verweist er auf jene Fragen und Probleme, die mit quantifizierenden Verfahren nicht zu klären sind. Insofern darf dieser Band auch und gerade als eine Steilvorlage für die historische Zunft gelten. Eine Kulturgeschichte des Politischen, für die die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus bisweilen noch immer wie eine Fahrt auf hoher See wirkt, findet in ihm einen soliden Anker.
CARSTEN KRETSCHMANN
Jürgen W. Falter (Herausgeber): Junge Kämpfer, alte Opportunisten. Die Mitglieder der NSDAP 1919-1945. Campus Verlag, Frankfurt am Main 2016. 499 S. 39,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main