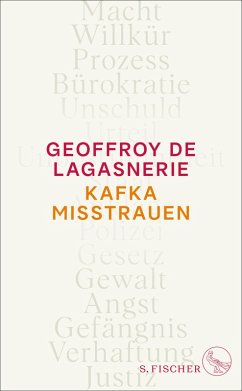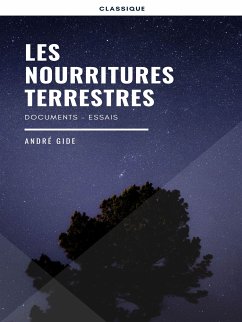Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH

Der französische Soziologe Geoffroy de Lagasnerie sagt, wir sollten "Kafka misstrauen". Vielleicht sollten wir aber lieber Lagasnerie misstrauen - und uns selbst.
Von Julia Encke
Der Titel ist natürlich erst mal großartig und auf den ersten Blick völlig angemessen. Der 3. Juni 2024 wird der hundertste Todestag des Schriftstellers Franz Kafka sein, bis dahin ist es eigentlich noch ein paar Monate hin. Doch schon jetzt erscheinen ein Film ("Die Herrlichkeit des Lebens") und eine Miniserie ("Kafka") über ihn, das "SZ-Magazin" druckte schon im Dezember ein Interview mit Kafka, in dem es den vierzig Jahre alten Patienten aus dem Einzelzimmer im zweiten Stock einer privaten Lungenheilstätte in Kierling bei Wien "mit heiserer Stimme", "rasselndem" Atem, "immer wieder von Hustenanfällen geschüttelt" in Zitaten zu Wort kommen ließ: "Herr Kafka, wie fühlen Sie sich? - Franz Kafka: Für alles unfähig außer für Schmerzen." Unter den vielen Büchern, die in diesem Frühjahr über Kafka erscheinen, befindet sich ein Band mit kurzen Beiträgen von Schriftstellern, die alle "Kafka gelesen" haben, weshalb der Verlag S. Fischer ihn für alle Lebenslagen anpreist: "Mit Kafka in den Baumarkt. Mit Kafka das Unvollendete erforschen. Mit Kafka auf die schriftstellerischen Anfänge zurückblicken . . ." Und dann kommt der französische Soziologe Geoffroy de Lagasnerie und nennt sein Buch, das ein Jubiläumsbuch ist wie die anderen auch: "Kafka misstrauen".
Lagasnerie wundert sich. Wie ist es zu erklären, dass wir uns so leicht in Kafka wiedererkennen?, fragt er. Warum spiegeln wir uns in seinen Figuren und bezeichnen unser eigenes Leben so gern als "kafkaesk"? Er hat diese Frage nicht erfunden, sondern knüpft an Adorno an, der in seinen "Aufzeichnungen zu Kafka" feststellte, dass man bei jedem seltsamen und unklaren Kafka-Satz dazu neige, sich zu wundern, dass man sich so leicht darin wiedererkenne. Was beschrieben werde, scheine Situationen widerzuspiegeln, die man selbst erlebt habe oder zu erleben befürchte. Kafka zu lesen, so Adorno, sei ein "déjà-vu in Permanenz" und bedeute, sich unablässig zu fragen: "Woher kenne ich das?" Angesichts der Jubiläumsselbstbespiegelungen, die uns wahrscheinlich das ganze Jahr begleiten werden, sollten wir diesem Déja-Vu-Effekt unbedingt auf den Grund gehen. Aber hat Lagasnerie selbst überhaupt eine Antwort darauf?
Der Soziologe und Philosoph, der in Paris als Professor lehrt und der Lebensgefährte seines Kollegen Didier Eribon ist (siehe Seite 38), was er in seinem vor Kurzem erschienenen Buch "Ein Leben außerhalb: Lob der Freundschaft" zum Thema gemacht hat ("D." ist jetzt auch das Kafka-Buch gewidmet), interessiert sich vor allem für Kafkas "Prozess", die Erzählungen "In der Strafkolonie" oder "Vor dem Gesetz", die im Buch komplett abgedruckt ist. In der riesigen Menge an Interpretationen der Gesellschaft und dessen, was wir sind, erscheine das Werk von Franz Kafka als eines, das einen zentralen Platz einnehme, um vor allem die Geheimnisse des Staates und der Administration zu erforschen, stellt Lagasnerie fest. Und findet das merkwürdig.
Denn sobald man von seinen Aufzeichnungen, Erzählungen und Parabeln diejenigen lese, die sich mit den Themen Strafe, Schuld und Staat befassen, stelle man fest, dass die Welten, die sie beschreiben, in völligem Widerspruch zu der Welt stehen, in der wir leben - sogar, so Lagasnerie, in Widerspruch zu fast allen bekannten Staatsformen: "Alles, was üblicherweise die Justizsysteme definiert, übrigens auch in monarchischen und autoritären Regimen, fehlt hier."
Geoffroy de Lagasneries Gewährsmann für die Nichtübereinstimmung der Kafka-Welt mit der unsrigen ist der Schriftsteller Jean Genet, der 1960 in einem Brief seine Unfähigkeit erklärte, von Kafka berührt zu sein: "Wie traurig! Habe mit diesem Kafka nichts zu tun", schrieb Genet - er selbst "ein realer Schuldiger vor einem realen Gericht". Wenn man wie Genet die Justiz kennengelernt habe, vor Richter und Staatsanwälten "aus Fleisch und Blut" habe treten müssen, dann könne man sich von einem Gericht, von dem man, wie in Kafkas "Prozess", "nichts weiß", nicht betroffen fühlen. "Was Josef K. passiert", so Genet, berühre ihn nicht, denn es passiere "niemandem".
Lagasnerie hat sich bis hierhin gewissermaßen warmgeschrieben und ist, das merkt man der etwas penetranten Wiederholungsstruktur seiner Argumentation an, kurz davor, wenn auch kalkuliert, die Fassung zu verlieren. Wie könne das eigentlich sein, dass wir ein Universum, das so offensichtlich Regeln folge, die den unseren fremd seien, als vertraut empfinden? Dass Kafkas "Anti-Welt" bei uns Déjà-vus hervorrufe? Das könne nur an Kafka liegen - und an uns selbst. Und ist überhaupt nicht gut. Oder besser: Kafka bringt in uns die schlechtesten Seiten hervor. Geoffroy de Lagasnerie holt jetzt so richtig aus: Kafka "verführt" uns zur "Realitätsflucht"! Zu einem "Eskapismus der Sonderbarkeit", der verschleiere, dass "die Macht viel eher aus der Rigidität der Anwendung von Normen als aus einem Anarchismus der Regeln" hervorgehe. Kafka sei in Wahrheit überhaupt nur ein Poser! Er tue so, als ob er das Gesetz angreife, stelle es aber tatsächlich nie infrage. Im Gegenteil. Wenn die Rechtsordnung kohärent und zugänglich wäre, gäbe es nichts mehr zu sagen, und das kafkasche Subjekt würde seine Situation gar nicht als Albtraum erleben. Auf diese Weise sei hier, so der aufgebrachte Autor, "ein grundlegender Legitimismus der Rechtsnorm am Werk" - und "die Lektüre von Kafka in ihrer Wirkung zwangsläufig konservativ".
Der Vorwurf lautet also: Wir machen uns schuldig, wenn wir Kafka lesen. Mit kafkaesken Figuren lenken wir uns von dem ab, was täglich durch das Handeln von Richtern, Staatsanwälten, Polizisten geschehe. Kafkas Wahrnehmung von Macht sei von einem "abstrakten Individualismus" geprägt - ein Mann vor seinem Prozess, ein Soldat, der wegen Ungehorsams hingerichtet wird, ein Landvermesser, der ein Schloss sucht. Aber das Universum des Rechts sei ein Zusammenspiel gesellschaftlicher Kräfte, weshalb wir - es folgt der wohl verräterischste Satz von Geoffrey Lagasneries Polemik - statt Kafkas "individueller Sichtweise" eine "soziologische Sicht" einnehmen sollten. "Da es statistisch gesehen stimmt, dass der Strafstaat nicht Individuen, sondern Gruppen von Individuen einsperrt", so der Soziologe, "gibt es Josef K. nicht. Was es gibt, sind sozio-rassische Klassen, die dem repressiven Staatsapparat oder dem Fokus der Polizei mehr oder weniger ausgesetzt sind und deren Bestrafung eines der Instrumente darstellt, mit denen die soziale Ordnung Herrschaftsformen produzieren und reproduzieren kann."
Schon früh bei der Lektüre von Lagasneries "Kafka misstrauen" hat man - was zunächst nur an der donnernden Selbstgewissheit des Tons liegt - begonnen, Lagasnerie zu misstrauen. Bei den letzten Behauptungen traut man dann seinen Augen kaum mehr, aber die Sätze stehen da wirklich so auf dem Papier. Auf Radio France hat, als das Buch im Januar in Frankreich erschien, ein Kritiker dem Autor entgegengehalten, man könne "einem Zebra nicht seine Streifen vorwerfen". Kafka sei Schriftsteller und kein Soziologe, er habe auch nie behauptet oder für sich in Anspruch genommen, Soziologe zu sein oder sein zu wollen, weshalb man ihm schlecht zum Vorwurf machen könne, es nicht zu sein. Aber vielleicht ist das Ganze sogar noch viel banaler. Denn Geoffroy de Lagasnerie wirft Kafka nicht nur vor, keine soziologische Perspektive einzunehmen, er wirft ihm vor, nicht Geoffroy de Lagasnerie zu sein - und uns hält er vor, Kafka zu lesen, ja, "süchtig" nach ihm zu sein - "Wenn wir nach Kafka süchtig sind, dann vielleicht, weil wir nach dem Irrtum süchtig sind" - und nicht nach Lagasnerie, was der Argumentation zufolge gleichbedeutend wäre mit: nach Wahrheit.
Was mit einer interessanten Fragestellung beginnt, wenn Lagasnerie Adornos These vom Déjà-vu-Effekt bei der Kafkalektüre im Jahr des hundertsten Todestages neu zur Diskussion stellt, endet im Fiasko. Nicht "Kafka misstrauen" scheint der passende Titel dieser selbstgerechten Polemik mit ihrer eigentümlichen narzisstischen Dynamik zu sein, sondern "Kafka missbrauchen". Nichts anderes geht hier vor sich. Josef K. gibt es nicht? Dass es ihn gibt, hat auch niemand behauptet.
Interessant ist ja vor allem, was bei Lagasnerie alles so gut wie gar nicht vorkommt. Und das sind vor allem die bei Franz Kafka naheliegenden Worte "Literatur" und "Sprache". Der Soziologe liest Kafkas Erzählungen als Quellen zu Fragen der Macht und Rechtsprechung. Ohne sie diskursanalytisch in einen historischen Kontext zu stellen. Ohne ihre literarische Struktur zu beschreiben. Ohne die Funktion des literarischen Diskurses im gesellschaftlichen Zusammenhang zu reflektieren. Und vor allem: ohne Kafkas Sprache zum Thema zu machen. Er spricht also im Grunde überhaupt nicht über Kafka, sondern sucht sich ein paar Elemente aus dem Kafka-Kosmos zusammen, um sich selbst zu profilieren. "Wie traurig! Habe mit diesem Lagasnerie nichts zu tun!", möchte man mit Jean Genet sagen.
Denn wer von Macht bei Kafka spricht, ohne dessen Sprache zu erwähnen, dem entgeht, wie Gerhard Neumann in seinem Buch über Kafka als "Experten der Macht" festgestellt hat, "dass es die Sprache selbst ist, ihre Performanz, die Macht verleiht und Macht erleiden lässt; die also den Protagonisten wahlweise zum Verurteilten macht oder zu freiem Handeln befähigt". Das bedeutet nicht nur, dass auch Kafka - schreibend - um seine eigene Macht wusste, wie sich in seiner letzten Tagebuchaufzeichnung zeigt: "Der Trost wäre nur: Es geschieht, ob Du willst oder nicht. Und was Du willst, hilft nur unmerklich wenig. Mehr als Trost ist: Auch Du hast Waffen." Sondern auch, dass in der Darstellung von Macht und Ohnmacht Sprache selbst ein Machtfaktor ist.
Geoffroy de Lagasnerie: "Kafka misstrauen". Aus dem Französischen von Andrea Hemminger. Verlag S. Fischer, 80 Seiten, 18 Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
© Perlentaucher Medien GmbH