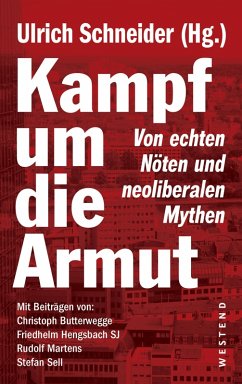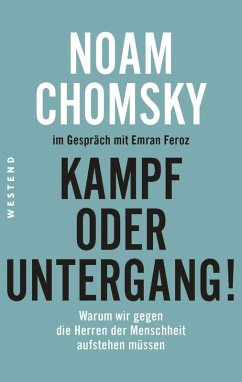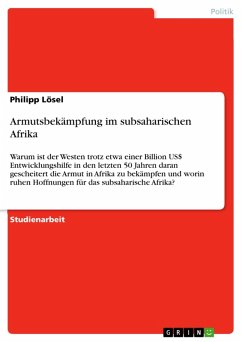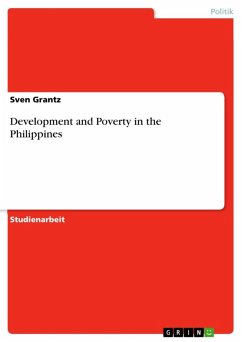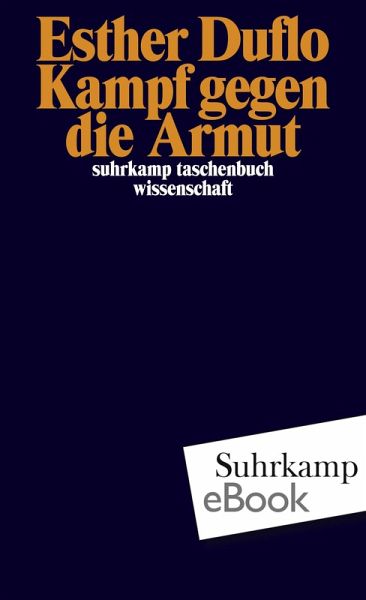
Kampf gegen die Armut (eBook, ePUB)
Wirtschaftnobelpreis 2019
Übersetzer: Hemminger, Andrea
Sofort per Download lieferbar
Statt: 16,00 €**
15,99 €
inkl. MwSt.
** Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Wirtschaftsnobelpreis 2019 für Esther DufloEsther Duflo gehört zu den Shooting Stars der internationalen Wissenschaft. Ihr Forschungsgebiet ist die Entwicklungsökonomie, also die Frage, wie Armut überwunden und wirtschaftliche Entwicklung angestoßen werden kann. Der »Economist« zählte sie 2008 zu den acht wichtigsten jungen Ökonomen und das »Time Magazine« 2011 zu den 100 einflussreichsten Menschen der Erde. In »Kampf gegen die Armut« stellt Duflo ihren innovativen entwicklungsökonomischen Ansatz anhand von vier zentralen Problembereichen vor: Bildung, Gesundheit, Mikrokredite un...
Wirtschaftsnobelpreis 2019 für Esther Duflo
Esther Duflo gehört zu den Shooting Stars der internationalen Wissenschaft. Ihr Forschungsgebiet ist die Entwicklungsökonomie, also die Frage, wie Armut überwunden und wirtschaftliche Entwicklung angestoßen werden kann. Der »Economist« zählte sie 2008 zu den acht wichtigsten jungen Ökonomen und das »Time Magazine« 2011 zu den 100 einflussreichsten Menschen der Erde. In »Kampf gegen die Armut« stellt Duflo ihren innovativen entwicklungsökonomischen Ansatz anhand von vier zentralen Problembereichen vor: Bildung, Gesundheit, Mikrokredite und Institutionen/Korruption. Über randomisierte Tests, die von der Praxis klinischer Studien in der Medizin inspiriert sind, werden konkrete entwicklungspolitische Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit überprüft, mit nicht selten überraschenden Ergebnissen. Ein Buch, das die Entwicklungsökonomie auf eine neue Grundlage stellt.
Esther Duflo gehört zu den Shooting Stars der internationalen Wissenschaft. Ihr Forschungsgebiet ist die Entwicklungsökonomie, also die Frage, wie Armut überwunden und wirtschaftliche Entwicklung angestoßen werden kann. Der »Economist« zählte sie 2008 zu den acht wichtigsten jungen Ökonomen und das »Time Magazine« 2011 zu den 100 einflussreichsten Menschen der Erde. In »Kampf gegen die Armut« stellt Duflo ihren innovativen entwicklungsökonomischen Ansatz anhand von vier zentralen Problembereichen vor: Bildung, Gesundheit, Mikrokredite und Institutionen/Korruption. Über randomisierte Tests, die von der Praxis klinischer Studien in der Medizin inspiriert sind, werden konkrete entwicklungspolitische Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit überprüft, mit nicht selten überraschenden Ergebnissen. Ein Buch, das die Entwicklungsökonomie auf eine neue Grundlage stellt.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, I ausgeliefert werden.