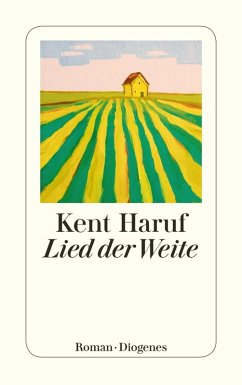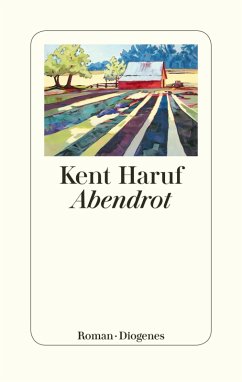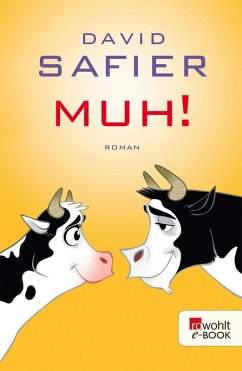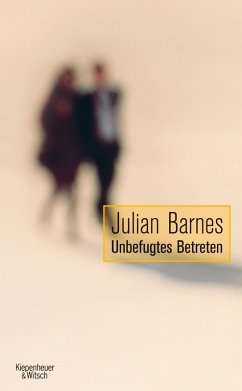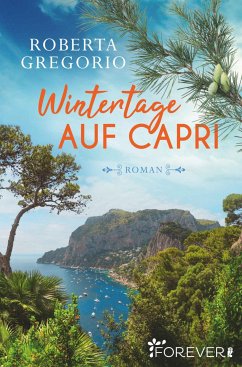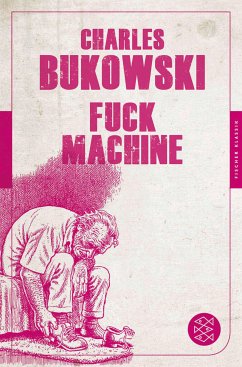Kanns nicht und wills nicht (eBook, ePUB)
Stories
Übersetzer: Hoffer, Klaus
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 23,00 €**
18,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Ihre Erzählungen sind manchmal buchstäbliche Einzeiler; oder es sind lange geduldige Beobachtungen von Kühen im Laufe eines Winters vom Küchenfenster eines Landhauses aus. Ihre Stories können aber auch Träume sein, Beschwerdebriefe (an Tiefkühlerbsenproduzenten oder Autoren von Buchhändler-Werbebroschüren) oder Geschichten, die aus den Briefen Flauberts kondensiert wurden. Lydia Davis schreibt in allen Fällen mit großer Präzision, mit Witz und Intelligenz und einem geschärften Blick für die Unerfreulichkeiten des täglichen Lebens. Da sie nichts als gegeben hinnimmt, überschreit...
Ihre Erzählungen sind manchmal buchstäbliche Einzeiler; oder es sind lange geduldige Beobachtungen von Kühen im Laufe eines Winters vom Küchenfenster eines Landhauses aus. Ihre Stories können aber auch Träume sein, Beschwerdebriefe (an Tiefkühlerbsenproduzenten oder Autoren von Buchhändler-Werbebroschüren) oder Geschichten, die aus den Briefen Flauberts kondensiert wurden. Lydia Davis schreibt in allen Fällen mit großer Präzision, mit Witz und Intelligenz und einem geschärften Blick für die Unerfreulichkeiten des täglichen Lebens. Da sie nichts als gegeben hinnimmt, überschreitet sie auch ständig die Grenzen der literarischen Konventionen, der Genres und Gepflogenheiten - und das macht ihr Werk zu einer Fundgrube für überraschende Entdeckungen. Sie scheut weder das intellektuelle Vergnügen noch die Nähe der Intimität. Ob es sich um die ironische Aufzählung von Lesevorlieben handelt oder um die ungemein intimen Erinnerungen einer Frau an ihre verstorbene ältere Schwester, um die trocken notierten Schwierigkeiten mit renitenten Dienstmädchen oder die Essgewohnheiten von Großstadtneurotikern: Lydia Davis zu lesen erweitert nicht nur den Horizont, es weist uns auch auf unerwartete Freuden in unser aller rätselhaftem Alltag hin.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.




 buecher-magazin.deEin Beschwerdebrief über das Foto, das auf einer Packung Tiefkühlerbsen abgedruckt ist, gehört zu den Höhepunkten dieses Storybandes von Lydia Davis. Es ist ein scheinbar banaler Ausgangspunkt: Die Briefeschreiberin glaubt, dass die Erbsen auf dem Bild nicht gut genug abgelichtet sind, da die Farbe nicht annähernd die Realität widerspiegelt. Ihr Brief mündet dann in einer detaillierten Beschreibung der verschiedensten Tiefkühlerbsenfarben und besticht durch eine absurde, sonderbare und schrullige Komik, die auf die genaue Beobachtungs- und Sprachgabe der Verfasserin hinweist. Lydia Davis hat Beschwerdebriefe als literarische Form perfektioniert, in ihnen offenbart sich ihr genauer, sehr eigener Blick, der zu erstaunlichen Rückschlüssen führt. Dabei enthält "Kanns nicht und wills nicht" Traum-Geschichten, Episoden von Flaubert und Beobachtungen von alltäglichen Begebenheiten, die dank des Davis-Blicks zu überraschenden Offenbarungen führen. So wird aus einem möglichen Teppichverkauf eine Geschichte über die Unentschlossenheit. Manche mögen sagen, diese Sätze und kurzen Passagen seien keine Geschichten, aber Lydia Davis schert sich nicht um Konventionen. Mitunter ist der Ton trauriger und düsterer geworden, aber er fügt sich ein in diesen besonderen Stil.
buecher-magazin.deEin Beschwerdebrief über das Foto, das auf einer Packung Tiefkühlerbsen abgedruckt ist, gehört zu den Höhepunkten dieses Storybandes von Lydia Davis. Es ist ein scheinbar banaler Ausgangspunkt: Die Briefeschreiberin glaubt, dass die Erbsen auf dem Bild nicht gut genug abgelichtet sind, da die Farbe nicht annähernd die Realität widerspiegelt. Ihr Brief mündet dann in einer detaillierten Beschreibung der verschiedensten Tiefkühlerbsenfarben und besticht durch eine absurde, sonderbare und schrullige Komik, die auf die genaue Beobachtungs- und Sprachgabe der Verfasserin hinweist. Lydia Davis hat Beschwerdebriefe als literarische Form perfektioniert, in ihnen offenbart sich ihr genauer, sehr eigener Blick, der zu erstaunlichen Rückschlüssen führt. Dabei enthält "Kanns nicht und wills nicht" Traum-Geschichten, Episoden von Flaubert und Beobachtungen von alltäglichen Begebenheiten, die dank des Davis-Blicks zu überraschenden Offenbarungen führen. So wird aus einem möglichen Teppichverkauf eine Geschichte über die Unentschlossenheit. Manche mögen sagen, diese Sätze und kurzen Passagen seien keine Geschichten, aber Lydia Davis schert sich nicht um Konventionen. Mitunter ist der Ton trauriger und düsterer geworden, aber er fügt sich ein in diesen besonderen Stil.